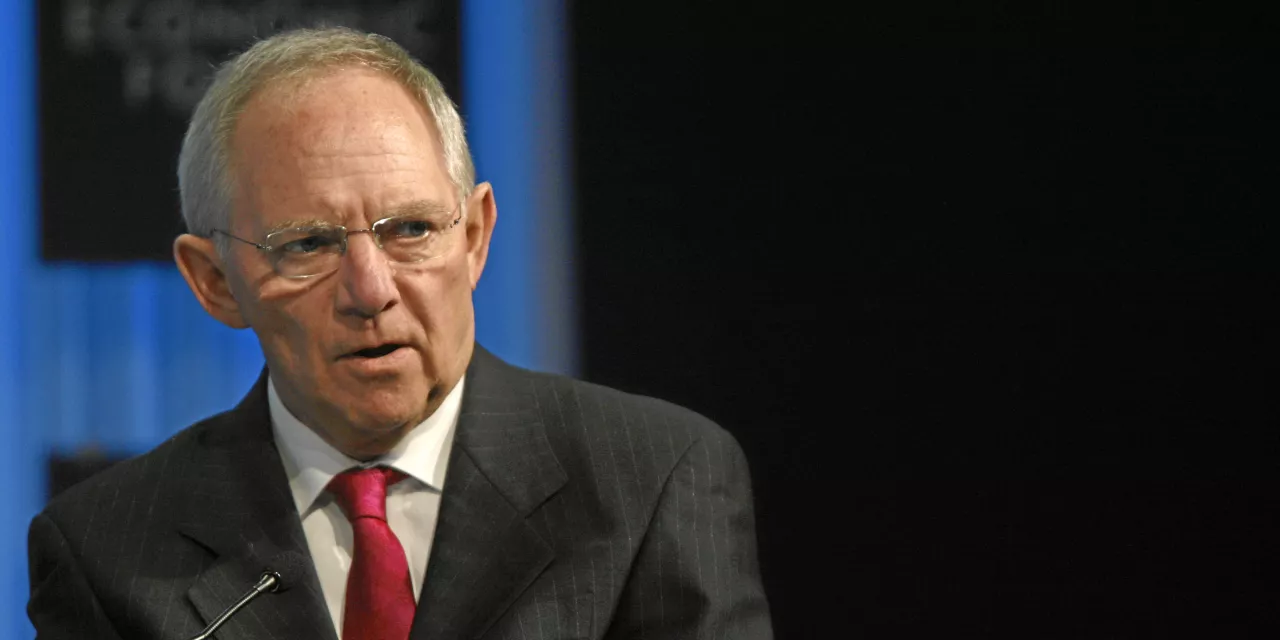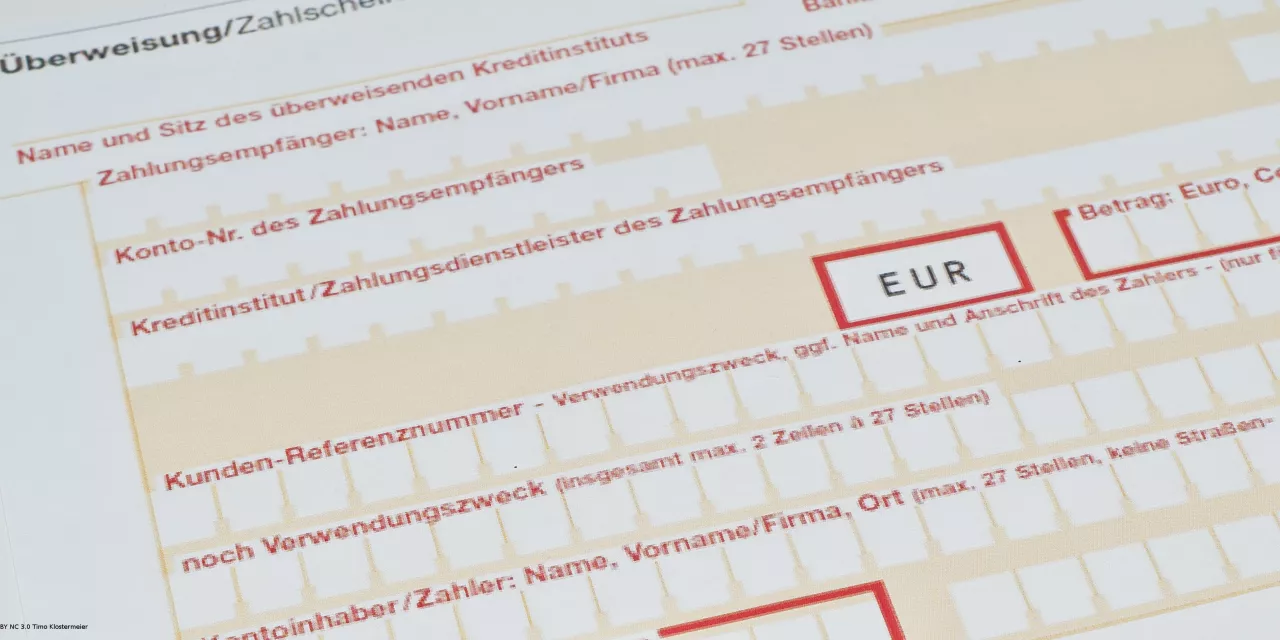Der BigBrotherAward in der Kategorie „Kommunikation“ geht an die Bundesministerin der Justiz, Frau Bundesministerin Zypries. Sie werden ausgezeichnet für Ihren Gesetzentwurf, mit dem in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikations-Verbindungsdaten eingeführt werden soll. Sie ignorieren damit bewusst die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das bereits 1983 im Volkszählungsurteil festgelegt hatte, dass die Sammlung von nicht anonymisierten Daten zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren Zwecken mit dem Grundgesetz unvereinbar ist.
Ausgangspunkt für Ihren Gesetzentwurf ist die Richtlinie mit der amtlichen Bezeichnung „2006/24/EG“ der Europäischen Union. Nach dieser Richtlinie müssen alle Mitgliedsstaaten die Anbieter und Betreiber von öffentlichen Kommunikationsnetzen zur Speicherung der sogenannten Verkehrsdaten verpflichten. Ein konkreter Anlass ist für diese Erfassung der TK-Nutzer nicht erforderlich. Mit diesen Daten soll die eindeutige Rückverfolgung und Identifizierung der Quelle und des Adressaten einer Nachricht nach Datum, Uhrzeit, Dauer, Art der Nachrichtenübermittlung sowie die Bestimmung der Endeinrichtung und des Standorts mobiler Geräte, also etwa Handys, ermöglicht werden. Als Speicherdauer ist ein Zeitraum von 6 Monaten bis zu zwei Jahren vorgesehen. Auch Deutschland würde diese Richtlinie umsetzen müssen – wenn sie denn so bleibt. Das aber ist fraglich, denn gegen diese Richtlinie hat Irland bereits am 6. Juli 2006 eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Bislang ist nicht klar, wann es zu einer Entscheidung kommen wird.
Die Jury der BigBrotherAwards hat durchaus nicht verkannt, dass es sich bei der genannten Richtlinie um einen den deutschen Gesetzgeber verpflichtenden Rechtsakt der EU handelt. Im Falle der Weigerung einer Umsetzung würde dies ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland nach sich ziehen. Wir haben darüber hinaus berücksichtigt, dass bereits heute – allerdings zu Abrechnungszwecken – einzelne Verkehrsdaten von den TK-Anbietern gespeichert werden. Und schließlich ist uns wohl bekannt, dass Sie, Frau Zypries, die nach der Richtlinie mögliche Mindestspeicherdauer von sechs Monaten in Ihr Umsetzungsgesetz aufgenommen haben.
Diese Erwägungen entlasten Sie, Frau Bundesministerin, als Preisträgerin aber nur sehr begrenzt. Denn: Die verdachtslose Speicherung von Verkehrsdaten ist mit der bereits angesprochenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts offensichtlich nicht in Einklang zu bringen. Nationale Judikatur und europäische Gesetzgebung sind hier offenbar im Widerstreit. Das hätte Sie veranlassen können, auf einen Beitritt Deutschlands zur irischen Klage hinzuwirken. Zumindest aber hätte dies Anlass sein sollen, das Gesetzgebungsverfahren jedenfalls bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zurückzustellen. Denn wenn Irland mit seiner Klage gegen die EU-Richtlinie erfolgreich ist, muss sie natürlich auch in Deutschland nicht umgesetzt werden.
Aus den folgenden Gründen hätten wir von Ihnen, Frau Zypries, erwartet, dass Sie die EU-Richtlinie nicht in einen deutschen Gesetzentwurf formulieren, selbst wenn Sie damit das Risiko eines Vertragsverletzungsverfahrens eingehen: Die Information, wer zu welcher Zeit mit wem wie lange und von wo aus kommuniziert hat, ist in einer freien Kommunikations-Gesellschaft viel zu wichtig, als dass man diese Daten anlassunabhängig über jedermann speichern dürfte. Schließlich ist damit unvermeidbar der über die gesamte Bevölkerung ausgesprochene Verdacht verbunden, dass die Daten zu einem späteren Zeitpunkt einmal für Zwecke der Strafverfolgung benötigt werden könnten. Immerhin könnte sich jede und jeder einzelne von uns irgendwann einmal zum Gesetzesbrecher entwickeln.
Und Sie sprechen im Zusammenhang mit Ihrem Gesetzentwurf außerdem von „Gefahrenabwehr“. Sie halten uns Bürger also sämtlich für potentiell gefährlich? Außerdem argumentieren Sie, dass die deutschen Geheimdienste zu einem späteren Zeitpunkt unsere Daten nützlich finden könnten. Wir könnten uns ja binnen Halbjahresfrist zu Verfassungsfeinden entwickeln und dann wäre es in Ihren Augen natürlich schade, wenn die Schlapphüte nicht ermitteln könnten, mit wem wir im letzten halben Jahr Kontakt hatten.
Der deutsche Bundestag war bereits im Jahr 2005 mit der Frage befasst, ob in Deutschland eine Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden sollte. Nach durchaus kontroverser Diskussion wurde dies, unter anderem aufgrund der genannten verfassungsrechtlichen Zweifel, ausdrücklich abgelehnt. Die Parlamentarier haben sich dabei von der Überzeugung tragen lassen, dass der Schutz der Kommunikationsbeziehungen der Bürger eine elementare Voraussetzung einer auf freier Kommunikation aufbauenden, demokratischen Gesellschaft ist. Dabei mag den Abgeordneten auch das bereits erwähnte Volkszählungsurteil in den Ohren geklungen haben: Unsicherheit über den Umfang staatlicher Datensammlungen kann dazu führen, dass wir unsere Grundrechte nicht mehr wahrnehmen.
Wir wünschen uns dringend, dass auch die Abgeordneten dieser Legislaturperiode im Blick behalten, wie sehr unser demokratischer Verfassungsstaat auf den freien, unbespitzelten zwischenmenschlichen Austausch angewiesen ist. Wir appellieren dringend an jeden Parlamentarier im Bundestag, Ihren Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung abzulehnen!
Und erlauben Sie mir, Frau Bundesjustizministerin, noch eine abschließende, mahnende Bemerkung: Bereits vor drei Jahren bestand Anlass, Sie für Ihr Festhalten am Großen Lauschangriff als Instrument der Strafverfolgung mit einem BigBrotherAward auszuzeichnen. Sollten sich in den nächsten Jahren keine Anzeichen für eine datenschutzmäßige Besserung ihrerseits ergeben, so wird sich die Jury früher oder später mit Ihrer Nominierung für den ungeliebten Life-Time-Award zu befassen haben.
Bis dahin sagen wir – leider schon zum zweiten Mal – Herzlichen Glückwunsch, Frau Bundesjustizministerin Zypries.
Laudator.in