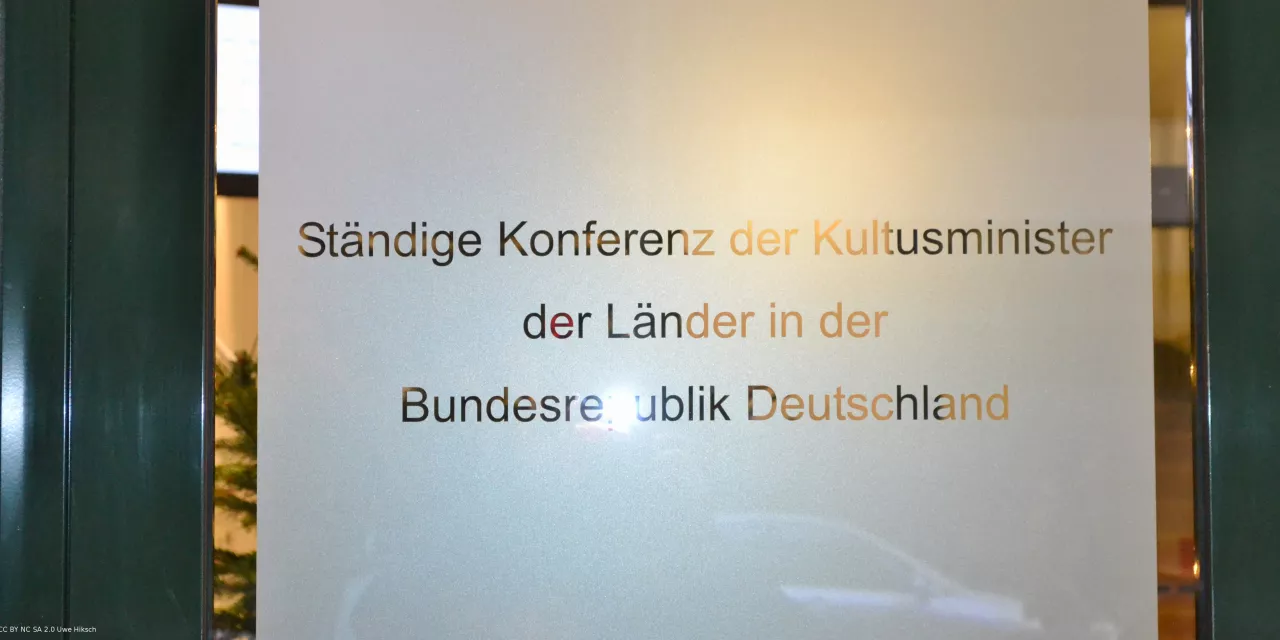Der Big Brother Award 2006 in der Kategorie "Behörden & Verwaltung" geht an die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) für das vollständige Ignorieren (der Amtsschimmel würde sagen: "die fehlende Berücksichtigung") von Datenschutzanforderungen beim Versuch, bundesweit einheitliche, lebenslange Schüler-IDs einzuführen.
Man könnte zur Entschuldigung anführen, dass Jura nicht als allgemeines Schulfach gelehrt wird, die Damen und Herren der KMK also nicht notwendig juristische Kenntnisse besitzen, wenn sie das deutsche Bildungssystem durchlaufen haben.
Sollte man nicht aber zumindest Kenntnisse über demokratische Grundsätze vorweisen können, wenn man die Gesetzgebung lenken will? Und sollten diese nicht mindestens im Sozialkundeunterricht soweit vermittelt worden sein, dass man Bedeutung und Anforderungen von Datenschutz, informationeller Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrecht erfasst und verstanden hat? Der Anspruch scheint bei den Mitgliedern der KMK nicht erfüllt worden zu sein. Ein PISA-gleiches Desaster in Sachen Datenschutz und Demokratieverständnis!
Doch - fangen wir von vorne an:
Seit dem Jahre 2000 unternimmt die KMK Bemühungen, schulstatistische Daten länderübergreifend einheitlich zu gestalten, zentral zusammenzufassen und personenbezogen (und zwar auf Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer bezogen) zu erheben.
Sie rechtfertigt dies mit dem grundsätzlich nachvollziehbaren Hinweis auf die Notwendigkeit verlässlicher statistischer Daten als Grundlage für bildungspolitische Weichenstellungen. Nicht erst seit PISA und der neuesten OECD-Studie ist offensichtlich, dass in unserem Schulsystem einiges im Argen liegt und grundlegende Änderungen bitter nötig sind. Ob jedoch die angeblich mangelhaften Statistiken in erster Linie für die Fehlentwicklungen verantwortlich sind und ob - ganz in der Argumentationstradition zahlengläubiger Controller - ausgerechnet personenbezogene Zahlen die inhaltliche Wende bringen werden, sei einmal dahingestellt.
Im Mai 2003 hat die 174. Amtschefkonferenz der KMK unter dem Stichwort "Kerndatensatz für schulstatistische Individualdaten der Länder" eine "baldige Umstellung der Schulstatistik auf Individualdaten" vereinbart. Dahinter verbirgt sich die Forderung an die Länder, durch geeignete Vorgaben und Gesetzgebung eine einheitliche Datenerfassung in staatlichen und privaten Vorschul-, Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen zu schaffen.
Von der Wiege bis zur Bahre - zumindest aber bis zum ersten Job oder der Entlassung in die Arbeitslosigkeit sollen alle Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, sowie von Schulen des Gesundheitswesens und in Zukunft möglichst auch der Vorschulen und in der Erwachsenenbildung eine eindeutige und einmalige Kennnummer erhalten, unter der in Zukunft ihr vollständiges Bildungsprofil angelegt werden soll.
Dies erfordert, dass die in den einzelnen Ländern verwendeten Schulverwaltungsprogramme bei jedem Vorgang im Sekretariat mindestens die durch die KMK definierten Kerndaten erfassen. Technisch müssen sie in der Lage sein, diese an die zentrale Statistik übermitteln zu können. Zu erfassen sind neben Geschlecht und Geburtsdatum unter anderem auch Angaben über Muttersprache und Staatsangehörigkeit, Konfession, die Schule und den besuchten Unterricht, Förderschwerpunkte (also auffällige Defizite in bestimmten Lernbereichen) und ob jemand Spätaussiedler oder Migrantin ist. Übrigens werden auch über die Lehrkräfte umfangreiche personenbezogene Daten erfasst. Die erforderliche Mitbestimmung wird von der KMK anscheinend überhaupt nicht wahrgenommen.
Wen wird wohl diese nationale Bildungsdatenbank interessieren, wenn sie denn erst einmal besteht? Haben wir nicht gerade bei TollCollect gelernt, dass eine heute versprochene, noch so deutliche gesetzliche Zweckbegrenzung und ein aufwändiges Datenschutzkonzept nicht vor einer beliebigen "Umwidmung" schützen - wenn nur der entsprechende politische Druck entwickelt wird? Ist es also wirklich so unwahrscheinlich, dass sich nicht nur Polizei und Sicherheitsdienste für eine solch schöne Zusammenstellung interessieren, sondern auch Arbeitgeber, Hausbank und Versicherung? Sie wollen einen Kredit? Wo Sie den Abschluss nur mit Hängen und Würgen geschafft haben? Da könnte es sein, dass Ihre Bank Zweifel bekommt, ob Ihr Job ausreichend sicher ist und Sie den Kredit sicher zurückzahlen können. Sie kamen mal in den Genuss des Förderschwerpunkts "Emotionale und soziale Entwicklung"? Sorry, da stehen die Chancen schlecht, einen Ausbildungsplatz im Bankgewerbe zu bekommen.
Müssen wir in Zukunft befürchten, dass wir mit 30 in Bremen keinen Kredit, keine Lebensversicherung oder Job mehr bekommen, weil wir zwischen 12 und 18 in München drei Klassen wiederholt haben? Das halten Sie für übertriebene Befürchtungen? Sie denken, dass die KMK derartige Zwecke sicher ausgeschlossen hat?
Das wirklich Schlimme ist: die KMK ist noch nicht einmal so weit gekommen, sich über die gewünschten Zwecke auch nur annähernd nachvollziehbare Gedanken zu machen und diese zu formulieren. Es gibt keinerlei Dokumentation über konkrete Zwecke und Fragestellungen, die mithilfe der gesammelten Daten erfüllt und beantwortet werden sollen. Ein Versäumnis bei einem seit sechs Jahren verfolgten Projekt, das jedem privatwirtschaftlichen Unternehmen bei einer Datenschutz-Prüfung einen berechtigten Rüffel der Aufsichtsbehörde eingetragen hätte. Und genauso wenig ist befriedigend definiert, welche Stellen die zentrale Datenbank mit welcher Aufgabenstellung wo betreiben sollen.
Ganz in der Tradition von Jägern und Sammlern wird aber fleißig definiert und eingefordert, was denn alles erfasst werden soll. Da werden Stammdatensätze beschrieben, Export-Schnittstellen definiert, Ländersoftware umgestrickt, Schulen vergattert und es wird viel Druck entfaltet. Nur: genauso wenig wie man sich über die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Schüler und Schülerinnen und der Lehrkräfte Gedanken gemacht hat, so wenig kümmert man sich auch um die Festlegung technischer und organisatorischer Schutzmaßnahmen. "Wer darf wann was womit?" ist keine Frage, die den Damen und Herren der KMK jemals in den Sinn gekommen zu sein scheint. Zugriffs-, Berechtigungs- und Rollenkonzept? Fehlanzeige! Schutz der Kommunikations- und Übertragungswege? Fehlanzeige! Mindestanforderungen an Berechtigungssysteme der Schulsoftware? Fehlanzeige! Anonymisierungskonzepte? Fehlanzeige!
Hat die KMK überhaupt wahrgenommen, dass sie mit ihrem Projekt in erheblicher Weise in das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen eingreift? Ich fürchte, die Antwort lautet auch hier: Fehlanzeige!
Die Arbeitsgruppe "Datengewinnungsstrategie", die unter "fachlichen und pragmatischen Gesichtspunkten Handlungsempfehlungen priorisieren" soll, begreift Datenschutz jedenfalls offensichtlich nur noch als einen "mögliche Restriktionen" verursachenden Gesichtspunkt. Sie führt damit die Vorstellung der Kommission für Statistik weiter: Deren Verständnis von Datenschutz beschränkte sich 2005 in einem Bericht zum Umsetzungsstand lediglich auf das Referieren datenschutzrechtlicher Bedenken weniger Bundesländer. Darin wurde die Tatsache, dass Sachsen die Individualdatenerhebung vorläufig gestoppt hat und Schleswig-Holstein die Einbeziehung datenschutzrechtlicher Erwägungen anmahnt, offensichtlich nur noch als lästiges Querulantentum wahrgenommen.
Höchste Zeit also, dass die KMK das Verfahren "vom Kopf auf die Füße stellt", wie der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte fordert, und die grundlegenden Standards der Projekt- und Datenschutzorganisation beherzigt.
Herzlichen Glückwunsch, Kultusministerkonferenz! Setzen: Sechs.