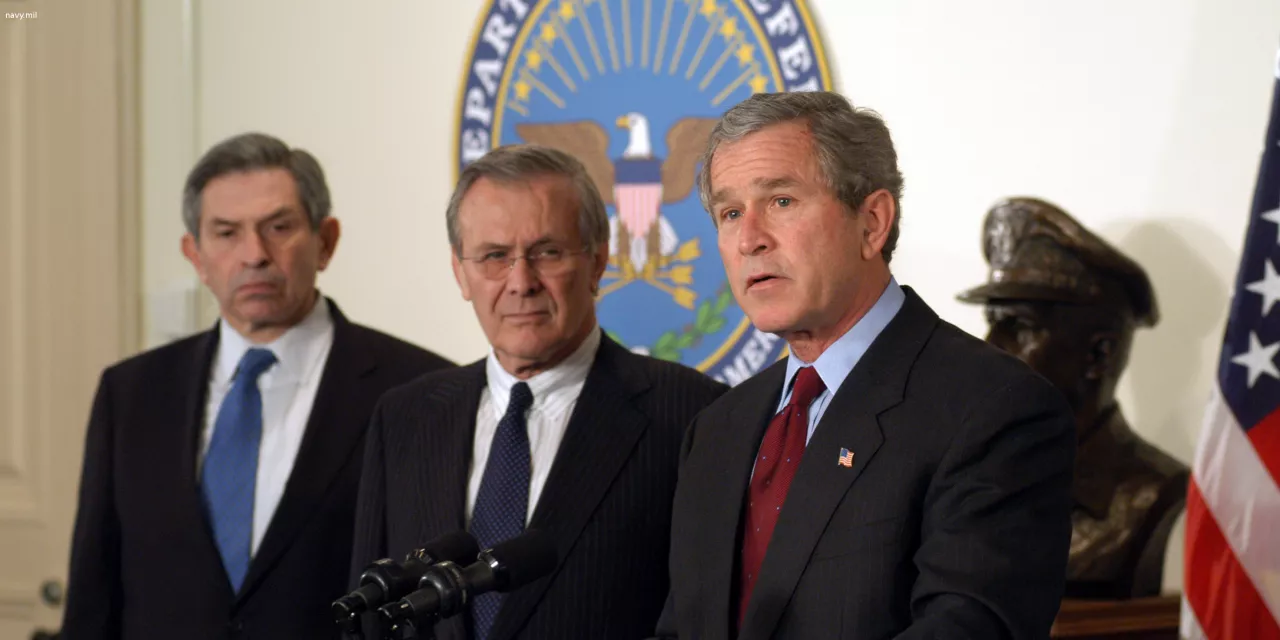In ihrem Extra-Markt "Future Store" in Rheinberg bei Duisburg testet die Metro-Gruppe seit April 2003 und einer werbewirksamen Eröffnung mit Claudia Schiffer den Einsatz von Transpondern oder so genannten RFIDs (RFID ist die Abkürzung für "Radio Frequency IDentification"- Identifizierung per Funk). Es handelt sich dabei um kleine Chips mit Antenne, die, wenn sie in die Nähe eines Lesegerätes gehalten werden, eine Identifikationsnummer aussenden.
Jeder Joghurtbecher, jede Weinflasche, jeder Pullover hat eine eigene Nummer, die ohne Berührungs- oder Sichtkontakt ausgelesen werden kann. Mit dem Lesegerät vernetzt können direkt Informationen zu diesem speziellen Gegenstand aufgerufen werden, zum Beispiel der Preis. Da auch Kunden-, Kredit- oder Payback-Karten zukünftig mit diesen kleinen Chips ausgerüstet werden, sind auch wir Kundinnen und Kunden damit eindeutig zu identifizieren. Das bietet völlig neue Möglichkeiten.
Auch wenn es Ihnen gleich unglaublich vorkommen wird: Die folgenden Szenarien sind entweder bereits Realität oder eng an die Marketing-Strategie-Papiere der RFID-Lobbyisten angelehnt.
April 2003
Der Future-Store in Rheinberg bei Duisburg eröffnet. Marion Z. als Test-Kundin ist beeindruckt: Wenn sie ihre neue Kundenkarte neben den Einkaufswagen hält, wird sie von einem Display auf dem Griff persönlich begrüßt und bekommt ihren persönlich abgespeicherten Standard-Einkaufszettel, den sie vorher angeben mußte, angezeigt. Bei jedem Einkauf ergänzt der Computer die Liste je nach den ihren persönlichen Vorlieben. Per "Navigationssystem" auf dem Display wird sie immer den optimalen Weg zum nächsten Produkt ihrer Einkaufsliste geführt. Such-Zeiten entfallen. Außerdem: Weil Diebstahl durch die RFIDs quasi unmöglich wird, sollen die Preise insgesamt sinken, heißt es. Das Aufs-Band-Legen an der Kasse entfällt, die Zahlung erfolgt per Karte. "Seeeeeehr praktisch!"
Mai 2003
Die ersten Vertreter des Handels besichtigen den Future Store und sind begeistert! Nie wieder sind Waren ausverkauft, das Nachfüllen der Regale kann zentral koordiniert werden. Keine Preisauszeichnung mehr, weil die Preise direkt vom Zentralrechner auf die Displays an den Einkaufswagen gegeben werden. Kunden können außerdem über die Displays individuell mit Werbespots angesprochen und beworben werden. Supermarkt-Pächter Dietmar K. jubelt "Eine Revolution für den Handel, wir gehen in ein goldenes Zeitalter!", in eine Fernsehkamera.
September 2003
Die Redaktion von Spiegel-Online fällt auf die Presse-Arbeit der Metro AG herein und lobt in einem redaktionellen Artikel ausschließlich die Vorteile für die Verbraucher. Zum Beispiel sei es jetzt möglich, dass Kunden sich über die Displays das genaue Herkunftsland der Waren anzeigen lassen. Der Einkauf werde viel transparenter. In der Marketing-Abteilung der Metro Gruppe knallen die Sektkorken. "Glauben die echt, dass wir so doof sind, und da rein schreiben, dass diese Kaffeebohnen von 5jährigen Kindern gepflückt worden sind???", wundert sich Praktikantin Nina S. Im Anschluß an die Feierstunde gibt sie weiter Umwege in das Navigationssystem des Einkaufswagen-Servers ein, damit er die Kunden an bestimmten Produkten vorbei führt.
Oktober 2003
Marion Z.aus Duisburg liest in der Zeitung einen Artikel zum Big Brother Award und ist erschrocken über die Überwachungsmöglichkeiten durch RFIDs. In einem Leserbrief wird abgewiegelt: RFIDs wäre ja gar nicht gefährlich, man könne sie ganz einfach in der Mikrowelle zerstören. Erschrocken wirft sie ihre letzten Future-Store-Einkäufe in die Mikrowelle. Die Butter schmilzt, der Reissverschluss an der Jeans sprüht Funken. O-Ton: "So ein Mist, das mache ich nicht noch mal!" Ob die Chips dabei kaputt gegangen sind, weiß sie nicht.
April 2004
Der Informatik-Student Lars H. (zweites Semester) entwickelt im Auftrag des FoeBuD e.V. in Bielefeld einen kleinen, einfachen Störsender, mit dem man das Auslesen der Daten der RFIDs verhindern kann. Marion Z. kauft sich einen davon. Lars H. bricht sein Studium ab und gründet ein Start-Up-Unternehmen für diese Störsender. Den Gewinn spendet er anteilig dem FoeBuD e.V.
Juni 2004
Die Supermarkt-Fachkraft Gerd J. ist begeistert von der neuen Technik. Das lästige An-der-Kasse-Sitzen fällt weg, die Regale sind leichter befüllbar, die Lager effektiver genutzt. Als er abends nach Hause kommt, liegt dort ein Brief seiner Geschäftsleitung mit einer Abmahnung. Er sei in den vergangenen Wochen durchschnittlich 9 Mal auf der Toilette gewesen und habe dort pro Tag ca. 72 Minuten zugebracht. Das liege 27 Minuten über dem Soll und diese Zeit werde ihm zukünftig von seinem Arbeitszeitkonto abgezogen. Entsetzt sucht er seinen Supermarkt-Kittel ab und findet einen RFID im Kragensaum.
September 2004
Die RFIDs kosten jetzt nur noch 1 Ct. pro Stück und unterliegen ab sofort einem gemeinsamen technischen Standard. Damit ist eine flächendeckende Einführung in greifbare Nähe gerückt.
Oktober 2004
Schafskäse-Hersteller Karsten P. hat inzwischen 10 Faxe der größten Handelsketten bekommen. Wenn er nicht innerhalb von drei Monaten RFIDs in alle seine Verpackungen integriert, werden die Lieferverträge mit ihm gekündigt. Karsten P., der sich bisher immer gegen diese Technik gesträubt hat, gibt auch im Sinne seiner 75 Mitarbeiter nach.
November 2004
Marion Z.bekommt einen Bußgeldbescheid der Stadt Duisburg. Das Papier eines von ihr gekauften Mars-Riegels wurde im Ententeich des Stadtparks gefunden. Marion Z.grübelt und kommt darauf, dass sie den Riegel einem Kind beim Martins-Singen geschenkt hat. Zähneknirschend zahlt sie 10 Euro Bußgeld.
Januar 2005
Startup-Unternehmer Lars H. ist krank. Er bittet seine Nachbarin Nina S., für ihn einkaufen zu gehen. Als sie ihm den Kassenbon präsentiert, ist er verwundert, dass Nina S. für viele Produkte das doppelte bezahlt hat. Sie stellen fest, dass zum Beispiel Toilettenartikel für sie teurer sind als für ihn. Beim Vergleich mit Freunden stellen sie fest, dass alle Frauen mehr für Toilettenartikel bezahlen als Männer, dass Familien mehr für Videos bezahlen als Singles usw. Ein Anruf bei der Verbraucherzentrale ergibt, dass das Wettbewerbsgesetz schon vor Monaten in irgendeiner Ladenschlußzeit-Novelle mit geändert worden ist. Gegen diese "Preis-Diskriminierung", wie der Fachbegriff lautet, könne man jetzt nichts mehr unternehmen.
April 2005
Supermarkt-Fachkraft Gerd J., inzwischen arbeitslos, weil er seine Toiletten-Zeiten nicht in den Griff bekommen hat, geht tanken. Da der RFIDs an der Kaugummi-Packung in seiner Jackentasche nicht im Supermarkt zerstört wurde, wird er als Kaugummi-Kauer identifiziert und die Tanksäule spielt ihm während des Wartens Werbespots für Konkurrenz-Kaugummis vor.
Juli 2005
Start-up Unternehmer Lars H. kauft sich einen neuen intelligenten Kühlschrank. Dieser Kühlschrank weiß aufgrund der RFIDs, was er geladen hat, welcher Joghurt am Verfallsdatum ist und was als nächstes eingekauft werden muss. Über das Internet kann der Kühlschrank selbständig nachbestellen oder den Display-Einkaufszettel im Supermarkt ergänzen. Außerdem macht er über ein Display in der Tür Rezeptvorschläge. Nachts träumt Lars H. davon, dass sein Kühlschrank für sich eigenmächtig jeden Abend eine Pizza Tonno bestellt und mit dem Toaster zusammen aufißt. Er wird schweißgebadet wach. Verkatert findet er morgens im Briefkasten eine Ermahnung seiner Krankenkasse. Sein Speiseplan weise zu viel Farb- und Konservierungsstoffe auf, steht da. Wenn er seine Ernährung nicht umstelle, werde ab Anfang kommenden Jahres sein Versicherungsbeitrag erhöht.
August 2005
Marion Z.steht vor ihrem Supermarkt und die Tür öffnet sich nicht. Die erste Frage des Marktleiters: "Haben Sie vielleicht einen Störsender in der Tasche? Nee, dann kommen sie hier auch nicht mehr rein." Das gleiche erlebt sie bei fast allen Supermärkten in ihrer Umgebung. Ab sofort lässt sie den Sender zu Hause. Abends findet sie im Altpapier einen Zeitungsartikel aus dem November 2003: "Datenschützer sehen Gespenster - Metro-Gruppe sagt, Schwarzmalerei völlig unrealistisch"
Wir wiederholen noch einmal: Die obigen Szenarien sind sehr eng an die konkreten Planungen der RFID-Lobbyisten angelehnt und werden zum Teil schon in Pilot-Projekten getestet. Es gibt vertrauliche Marketing-Strategie-Papiere, die von CASPIAN, einer amerikanischen Verbraucherschutzorganisation, gefunden und im Internet öffentlich zugänglich gemacht worden sind. Darin steht ausdrücklich, dass es eine der wichtigsten Aufgaben ist, die Sorge der Verbraucher um den Schutz ihrer Privatsphäre durch Marketing-Maßnahmen zu zerstreuen. Eine solche Zielvorgabe sollte besonders mißtrauisch machen.
Wir fordern, dass die RFIDs, die für die Waren-Logistik unwidersprochen praktisch sind, spätestens an der Ladenkasse, wenn die Ware in die Hände von uns Endverbrauchern und Endverbraucherinnen über geht, zerstört werden. Das ist durch einfache technische Vorrichtungen möglich.
Wir fordern, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher ein Recht darauf erhalten, zu wissen, wann RFIDs eingesetzt werden und welche Daten darin gespeichert sind und wann, wo, von wem und zu welchem Zweck die uns umgebenden RFIDs ausgelesen werden.
Zur Zeit wird das "Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb" (UWG) überarbeitet. Bisher regelte es nur die Beziehungen zwischen Firmen. In der Novellierung sollen jetzt auch die Verbraucher-Rechte ausdrücklich mit eingebunden werden. Eine gute Gelegenheit, das Zukunfts-Thema RFIDs und die daraus erwartbaren Szenarien wie z. B. Preisdiskriminierung gleich mit zu berücksichtigen.
RFIDs definieren das Wort "Konsum-Terror" völlig neu - spätestens, wenn sich ein internationaler Standard durchgesetzt hat. Durch ausspionierte, gesammelte Kundenprofile wird eine neue Dimension von Werbemaßnahmen und gezielten Manipulationen möglich, die einem selbst bestimmten Leben entgegen stehen. Und niemand wird sich dem mehr entziehen können.
Der Future-Store ist eine Versuchsstation für viele, aber längst nicht alle denkbaren Szenarien. Für seine Einrichtung und das Marketing-Konzept bekommt die Metro-Gruppe einen exemplarischen und zukunftsweisenden BigBrotherAward. Schade, dass sich das Unternehmen diesem Dialog hier und heute nicht stellt. Um so mehr sind Kunden, Verbraucherinitiativen und Politiker aufgefordert, diese Entwicklung, die unser Leben so elementar verändern kann, nicht allein den Konzernen zu überlassen.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Metro Gruppe!