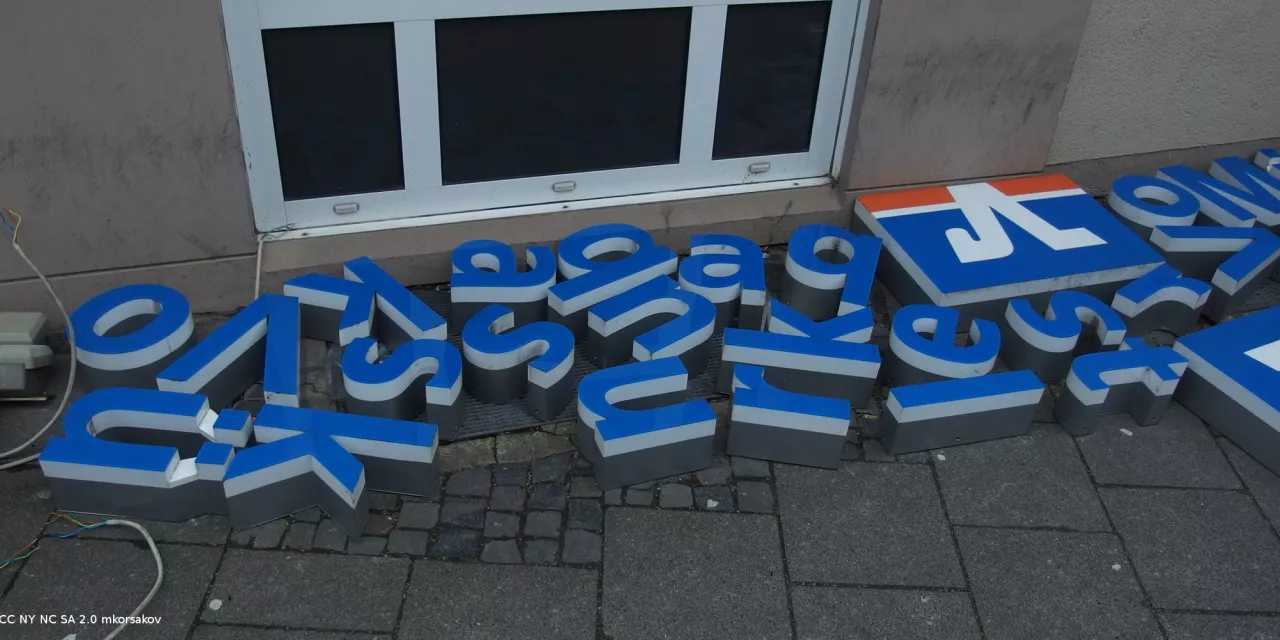Der Big Brother Award 2005 in der Kategorie "Lifetime" geht an Bundesinnenminister (a.D.) Otto Schily (SPD).
Otto Schily erhielt in diesem Jahr mit Abstand die meisten Nominierungen - wie übrigens schon im Jahr 2001, als er für seine "Otto-Kataloge" den "BigBrotherAward" in der Kategorie "Politik" verliehen bekam. In der Jury bestand große Einigkeit, dass Schily in diesem Jahr, zum mutmaßlichen Ende seiner politischen Karriere, der "Lifetime-Award" für langjährige "Verdienste" gebührt - wohlwissend, dass wir mit unserer Würdigung im Rahmen der Verleihung eines Negativpreises einer so schillernden Persönlichkeit wie Otto Schily und seiner gesamten Lebensleistung bei Weitem nicht gerecht werden können. Leider können wir hier und heute nur eine Auswahl aus der Fülle seiner beeindruckendsten Projekte und Initiativen würdigen.
Otto Schily erhält den BigBrother-Lifetime-Award 2005
- für die übereilte Einführung des biometrischen ePasses mit unausgereifter Technologie und ohne parlamentarische Legitimation,
- für seine "Verdienste" um den Ausbau des deutschen und europäischen Überwachungssystems auf Kosten der Bürger- und Freiheitsrechte,
- für seine hartnäckigen Bemühungen um die Aushöhlung des Datenschutzes und der Informationellen Selbstbestimmung unter dem Deckmantel von Sicherheit und Terrorbekämpfung - Stichwort: "Antiterror"-Gesetze, auch "Otto-Kataloge" genannt,
- für seine maßgebliche Mitwirkung am Großen Lauschangriff sowie
- für seine Angriffe auf die Unabhängigkeit des Bundesdatenschutzbeauftragten.
Zu den großen Obsessionen unseres Preisträgers gehört die digitale Erfassung von biometrischen Merkmalen in Ausweispapieren. Schon ab 1. November 2005, also in wenigen Tagen, wird in der Bundesrepublik als erstem EU-Land der Reisepass mit solchen Merkmalen ausgerüstet. Auf einem kontaktlos per Funk auslesbaren RFID-Mikrochip wird neben den Personalien zunächst ein digitalisiertes Gesichtsbild gespeichert, ab März 2007 kommen zwei digitale Fingerabdrücke hinzu. Die Speicherung weiterer Merkmale, etwa Irisscan oder genetischer Fingerabdruck, ist möglich. Der nächste Schritt wird die Einführung des biometrischen Personalausweises sein.
Unter souveräner Missachtung von Parlamenten und Datenschützern und ohne gesellschaftliche Debatte boxte Schily sein Lieblingsprojekt auf EU-Ebene durch - am Bundestag vorbei, ohne demokratische Legitimation. Statt das Parlament über die Folgen für Datenschutz und Bürgerrechte entscheiden zu lassen, forcierte er eine EU-Verordnung, die unmittelbare Gesetzeswirkung in allen EU-Ländern hat. So brachte es Schily fertig, das Pass-Gesetz (§ 4) zu umgehen, das zur Festlegung der biometrischen Daten ein neues, vom Bundestag zu beschließendes Gesetz fordert.
Nicht nur wir halten Schilys selbstherrlichen Akt für zutiefst undemokratisch. Als der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar (Grüne) diese übereilte Einführung des ePasses durch die europäische Hintertür kritisierte und ein umfassendes sicherheitstechnisches Konzept zum Schutz der Daten forderte, bezichtigte ihn Otto Schily des Amtsmissbrauchs. Es liege nicht in Schaars Kompetenz, über Sinn und Zeitpunkt der Einführung biometrischer Merkmale zu befinden, wies ihn Schily via Deutschlandfunk zurecht und empfahl ihm gebieterisch "mehr Zurückhaltung", auf dass er mit seinen Einwänden sein Amt nicht mehr missbrauche.
Mit diesem selbstgerechten Angriff auf die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten wollte der beratungsresistente Schily offenbar einen fachkundigen Kritiker in seinem eigenen Verantwortungsbereich zum Schweigen bringen. Doch es gehört zu den Pflichten eines Datenschutzbeauftragten, die betroffene Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass bis heute keine transparente Risikoanalyse existiert, um Missbrauch und Systemanfälligkeiten der Biometrie in Ausweisen überhaupt einschätzen zu können. Nach einer Studie des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die neue Technologie weder praxistauglich noch ausgereift. So ist die Gesichtserkennung stark fehlerbehaftet, allein schon, weil sich Gesichter im Laufe der Jahre erheblich verändern. Es steht zu befürchten, dass täglich Tausende Menschen an Flughäfen zurückgewiesen und in ihrer Reisefreiheit beschränkt werden, weil ihre digitalen Fotos oder Fingerabdrücke von der Software nicht akzeptiert werden oder einem Vergleich mit dem leibhaftigen Original nicht Stand halten. Solche Personen kommen in Rechtfertigungszwang, schlimmstenfalls geraten sie in einen bösen Verdacht. Schily nimmt das wissentlich in Kauf.
Elektronische Ausweise sind zudem missbrauchsanfällig: Die biometrischen Daten können an allen Kontrollstellen im In- und Ausland ausgelesen und in Datenbanken gespeichert werden - ohne dass die Betroffenen wissen, wer auf die sensiblen Daten Zugriff hat und was anschließend mit ihnen passiert. Selbst das kontaktlose und daher unbemerkte Auslesen der RFID-Chips per Funk ist nicht wirklich auszuschließen, so dass nicht nur Grenzkontrollstellen, sondern auch unbefugte Dritte Bewegungsprofile von arglosen Passinhabern anfertigen könnten.
Zwar konnten die Grünen im Bundestag Schilys ursprünglichen Plan, alle biometrischen Daten in einer Zentraldatei zu speichern, bislang noch verhindern. Doch auch dezentrale Speicherungen würden Risiken bergen: Mit geringem Mehraufwand könnten biometrische Passdaten aus dezentralen Dateien automatisch mit Fahndungsdateien und Fingerabdrücken von Straftätern und Verdächtigen abgeglichen werden, aber auch mit Fingerabdrücken, die an Tatorten gefunden werden. Und die digitalisierten Gesichtsbilder könnten etwa mit Video-Aufnahmen aus dem öffentlichen Raum abgeglichen werden, um eine verdächtige oder gesuchte Person herauszufiltern. Ein großer Schritt zum Generalverdacht gegen alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes - oder gleich ganz Europas, denn auf EU-Ebene gibt es bereits Pläne für eine biometrische Zentraldatei.
Im Zusammenhang mit elektronischen Ausweispapieren wird eine milliardenteure Überwachungsinfrastruktur mit hohem Missbrauchspotential aufgebaut. Für die Bürger steigen die Kosten eines Reisepasses um mehr als das Doppelte von 26 auf 59 Euro - wie hoch die staatlichen Subventionen pro ePass liegen, wagen wir nicht zu schätzen. Doch der riesige Kostenaufwand steht in keinem vernünftigen Verhältnis zum angeblichen Sicherheitsgewinn. Denn auch der ePass mit seinen biometrischen Merkmalen kann manipuliert werden. Im übrigen gelten die bisherigen bundesdeutschen Ausweispapiere schon jetzt als die fälschungssichersten der Welt. Gleichwohl verkaufte Otto Schily sein biometrisches Projekt als großen Fortschritt für die Sicherheit und als wichtigen Baustein im Kampf gegen organisierte Kriminalität und internationalen Terrorismus. Mit dieser Behauptung nährt Schily allenfalls eine riskante Sicherheitsillusion, denn der ePass führt keineswegs automatisch zu mehr Sicherheit. Weder die Selbstmord-Anschläge in New York, noch diejenigen von Madrid oder London hätten mit der neuen Technologie verhindert werden können. Schließlich gibt es kein biometrisches Merkmal, das signalisiert: "Dieser Pass gehört einem potentiellen Terroristen - bitte vor jedem Anschlagsversuch kontrollieren."
Otto Schily nötigte uns den ePass nicht nur als vermeintliches Sicherheitsinstrument auf, sondern auch als Innovationsprojekt zur Sicherung nationaler Standortvorteile: Die rasche Einführung der biometrischen Verfahren vor allen anderen EU-Staaten liege im ureigenen deutschen Interesse. Damit "bringen wir den Beweis", so Schily in einer Rede am 2. Juni 2005, "wie rasch sich deutsche Firmen auf die neue Sicherheitstechnik und auf den zukunftsorientierten Wachstumsmarkt der Biometrie eingestellt haben". Deutschland nehme so in Sachen Sicherheit eine Führungsrolle in der EU ein. Wir sehen darin allerdings eine verdeckte Wirtschaftsförderung, etwa zugunsten der Bundesdruckerei GmbH und der Chiphersteller Philips und Infineon, aber auch vorauseilenden Gehorsam gegenüber den USA, die in Sachen Biometrie auf die europäischen Regierungen massiven Druck ausgeübt hatten.
Die biometrisch-digitale Erfassung der gesamten Bevölkerung ist nicht nur ein unverhältnismäßiger Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung, sondern auch eine Misstrauenserklärung an die Bevölkerung. Sie muss sich behandeln lassen, wie bislang nur Tatverdächtige oder Kriminelle im Zuge einer Erkennungsdienstlichen Behandlung. Mit Schilys biometrischer Obsession werden Menschen im Namen vermeintlicher Sicherheit zu bloßen Objekten staatlicher Macht degradiert - ohne dass dies auch nur durch "Gefahrennähe" des Einzelnen gerechtfertigt wäre. Otto Schily kontert mit dem zynischen Argument, dass "die Würde des Fingers" auch nicht größer sei als die des Gesichts (lt. SZ 24.8.04). Im übrigen beruft er sich gerne auf spanische Ausweise, die bereits nicht-digitalisierte Fingerabdrücke enthalten. Allerdings verschweigt er, dass es sich dabei um ein Relikt aus faschistischen Franco-Zeiten handelt. Und er verschweigt, dass damit weder Anschläge der baskischen ETA noch die Anschläge von Madrid verhindert werden konnten.
Demnächst wird hierzulande selbst den hartnäckigsten Sicherheitsfanatikern das Lachen vergehen, denn ein solches wird auf den neuen Digitalfotos verboten sein - offene Münder oder blitzende Zähne könnten nämlich die Hightech-Lesegeräte irritieren. Lediglich ein leichtes Grinsen mit geschlossenen Lippen und bei ansonsten neutralem Gesichtsausdruck wird noch statthaft sein. Beim elektronischen Gesichtsabgleich werden wohl Vollbärte, dicke Brillen, aufgespritzte Lippen oder Nasenoperationen genauso zum Sicherheitsproblem, wie das unvermeidliche Älterwerden und deutlicher werdende Falten im Gesicht. -- Mit dem "BigBrother-Lifetime-Award" würdigen wir die Wandlung des anthroposophisch geprägten Preisträgers Otto Schily vom linksliberalen Anwalt über den realo-grünen Oppositionspolitiker zum staatsautoritären SPD-Polizeiminister - eine Metamorphose, die viele Menschen nur schwer nachvollziehen können. Vor vielen, vielen Jahren stand sein Name als herausragender Strafverteidiger der außerparlamentarischen Linken und besonders im Stammheimer RAF-Prozess für den Kampf gegen Deformationen des Rechtsstaates, die dieser damals im Zuge der Terrorismusbekämpfung erleiden musste. Es war jene Zeit, in der Schily noch die mahnenden Worte einer Erklärung der "Humanistischen Union" unterschrieben hatte: "Man bekämpft die Feinde des demokratischen Rechtsstaats nicht mit dessen Abbau, und man verteidigt die Freiheit nicht mit deren Einschränkung" (1978).
So ändern sich die Zeiten - dennoch will Schily von biografischen Brüchen nichts wissen: Vom "Terroristenprozess" in Stammheim bis zu seinen "Antiterror"-Gesetzen - kontinuierlich wähnte er sich im Einsatz für den Rechtsstaat, wenn auch in unterschiedlichen Rollen. Doch Schily hat nicht nur die Rollen, sondern die Seiten gewechselt - und zwar kompromisslos: Aus dem eloquenten Strafverteidiger, der im Interesse seiner Mandanten rechtsstaatliche Prinzipien gegen staatsautoritäre Übergriffe verteidigte, wurde spätestens in seiner Funktion als Bundesinnenminister ein autoritärer Staats-Anwalt, der die Macht des Staates zu Lasten der individuellen Freiheitsrechte ausgebaut hat. Schily machte den Staat zu seinem Mandanten, für dessen Autorität und Stärke er sich auf geradezu fundamentalistische Weise eingesetzt hat. Schon länger hält er die Angst vor dem Leviathan, also vor einer entfesselten Staatsmacht, für ein Problem von vorgestern. Der Einzelne müsse heute nicht mehr vor dem Staat geschützt werden, nur noch vor Kriminalität und Terror. Jedes Misstrauen gegen staatliche Maßnahmen ist im Schily-Staat demnach unangebracht, ja verwerflich, zumindest verdächtig.
Schon als Oppositionspolitiker hatte der von den Grünen zur SPD konvertierte Schily die spätere rot-grüne Koalition mit schweren Hypotheken belastet - so mit dem Großen Lauschangriff. Schily, der in Stammheim selbst Opfer von Lauschangriffen geworden war, hatte an der dafür nötigen Verfassungsänderung, die ohne die SPD nicht zustande gekommen wäre, maßgeblich mitgewirkt - und damit an der Aushöhlung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Jahre später hat das Bundesverfassungsgericht dieses Machwerk für weitgehend verfassungswidrig erklärt. Verfassungswidrige Betätigung - strenggenommen ein Fall für den "Verfassungsschutz", im Fall Schily offenbar eine höchst paradoxe Empfehlung für den Posten des Innenministers, der schließlich auch als Verfassungs(schutz)minister fungiert.
Als Geburtshelfer des Großen Lauschangriffs hatte Schily ursprünglich sogar für eine noch weit schärfere Fassung gefochten: Wäre es nach ihm gegangen, wären elektronische Wanzen auch gegen Berufsgeheimnisträger wie Journalisten oder Ärzte einsetzbar gewesen. Seit jener Zeit sind zumindest erhebliche Zweifel an seiner Verfassungstreue angebracht, zumal er zuvor schon die faktische Abschaffung des Asylgrundrechts betrieben hatte. Man muss sich seitdem fragen: Ist Schily bereit, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten, wie es von jedem Beamten gefordert wird, oder neigt er dazu, diese vermehrt zugunsten der Staatsräson und zu Lasten der Bürgerrechte einzuschränken?
Unser Preisträger hat mit seiner Law-and-order-Politik einen gehörigen Beitrag dazu geleistet, dass bürgerrechtliche Grundwerte in der herrschenden Sicherheitspolitik mehr und mehr verdrängt worden sind - ganz besonders nach den Terroranschlägen vom 11.9.2001 in den USA. Damals verkündete Schily als Bundesinnenminister, die rot-grüne Koalition werde "alle polizeilichen und militärischen Mittel aufbieten, über die die freiheitlich-demokratische Staatsordnung, die wehrhafte Demokratie verfügt". Mit dieser martialischen Androhung trat Schily einen fatalen Gesetzesaktionismus los, bediente den krankhaften Sicherheits-Wahn so mancher Bürger, und nutzte ihn zur Legitimierung langgehegter Nachrüstungspläne, ließ sie aus den Schubladen der Macht kramen, zu voluminösen "Otto-Katalogen" schnüren und mit Antiterror-Etiketten bekleben. Anstatt der Bevölkerung die Wahrheit über Unsicherheitsfaktoren in einer Risikogesellschaft zuzumuten und deutlich zu machen, dass absolute Sicherheit leider nicht und nirgendwo zu erreichen ist, machen Schily und andere Regierungspolitiker mit symbolischer Politik bis heute unhaltbare Sicherheitsversprechen.
Mit den sog. Antiterror-Gesetzen, für die Otto Schily wie kein anderer steht, haben Polizei und Geheimdienste erweiterte Aufgaben und Befugnisse erhalten. Damit wurde die ohnehin hohe Kontrolldichte in Staat und Gesellschaft noch weiter erhöht. Vermehrt können Beschäftigte in sog. lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen geheimdienstlichen Sicherheitsüberprüfungen unterzogen werden - mitunter auch ihre Lebenspartner und ihr soziales Umfeld. Betroffen sind Einrichtungen und sicherheitsempfindliche Stellen, so heißt es im Gesetz wörtlich, "die für das Funktionieren des Gemeinwesens unverzichtbar sind und deren Beeinträchtigung erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung entstehen lassen würde". Gemeint sind Einrichtungen, die der Versorgung der Bevölkerung dienen, wie Energie-Unternehmen, Krankenhäuser, Chemie-Anlagen, Bahn, Post, Banken, Telekommunikationsbetriebe, aber auch Rundfunk- und Fernsehanstalten können betroffen sein.
Migrantinnen und Migranten, unter ihnen besonders Muslime, werden praktisch per Gesetz unter Generalverdacht gestellt, zu gesteigerten Sicherheitsrisiken erklärt und einem rigiden Überwachungssystem unterworfen - denken wir nur an die biometrische Erfassung von Fingerabdrücken und Stimmprofilen, an geheimdienstliche Regelanfragen, an erleichterte Auslieferungen und Abschiebungen. Ohne wirklichen Nachweis, dass von ihnen mehr Terror ausgehe als von Deutschen, werden Migranten oft - unter Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes - einer entwürdigenden Sonderbehandlung unterzogen, die für viele existentielle Folgen haben kann.
Die "Antiterror"-Gesetze bewirken eine verhängnisvolle Lockerung des Datenschutzes, ganz im Sinne Otto Schilys, der den Datenschutz ohnehin für "übertrieben" hielt - gerade so, als könnten selbstmörderische Terroranschläge mit weniger Datenschutz und mehr Eingriffen in die Privatsphäre der Bürger verhindert werden. Doch die meisten Gesetzesverschärfungen taugen nur wenig zur Bekämpfung eines religiös-aufgeladenen, selbstmörderischen Terrors; sie schaffen kaum mehr Sicherheit, gefährden aber die Freiheitsrechte um so mehr. Etliche der Antiterror-Maßnahmen sind unverhältnismäßig, ja maßlos - sie zeigen Merkmale eines nicht erklärten Ausnahmezustands und eines autoritären Präventionsstaates, in dem letztlich Rechtssicherheit und Vertrauen verloren gehen. Die Unschuldsvermutung, eine der wichtigsten rechtsstaatlichen Errungenschaften, verliert in dieser Sicherheitskonzeption ihre machtbegrenzende Funktion. Der Mensch wird zum potentiellen Sicherheitsrisiko, der seine Harmlosigkeit und Unschuld nachweisen muss - während Otto Schily die vermeintliche Sicherheit zum Supergrundrecht erklärt, das die wirklichen Grundrechte der Bürger - als Abwehrrechte gegen Eingriffe des Staates - in den Schatten stellt.
In seinem missionarischen Eifer als Staatsschützer schreckte der Preisträger selbst vor extremistischen Forderungen aus dem Arsenal von Diktaturen nicht zurück: So würde er allzu gerne "gefährliche" Personen ohne konkreten Verdacht in präventive Sicherungshaft nehmen lassen. Otto Schilys zuweilen obrigkeitsstaatliche Interpretation des Rechtsstaats zeigt sich auch in seinen folgenden Staatschutzprojekten: Er hat mit einem gemeinsamen Antiterror-Lagezentrum und mit dem Plan einer zentralen "Islamistendatei" Grundsteine für einen Datenverbund aller Geheimdienste und des Bundeskriminalamts gelegt. Eine noch engere Vernetzung würde die Aufhebung des verfassungsmäßigen Gebots der Trennung von Polizei und Geheimdiensten bedeuten - immerhin eine Konsequenz aus den bitteren Erfahrungen mit der Gestapo im Nationalsozialismus. Damit nimmt Schily eine Machtkonzentration in Kauf, die kaum noch wirksam kontrollierbar sein wird.
Schily hat sich mit Vehemenz dafür eingesetzt, dass alle Telekommunikationskontakte - ob per Telefon, SMS, Email oder Internet - zur Terror- und Kriminalitätsbekämpfung deutschland- und europaweit für mindestens zwölf Monate auf Vorrat gespeichert werden. Also: Wer hat mit wem, wann, wie oft und wie lange von wo nach wo fernmündlich oder schriftlich kommuniziert, welche SMS- oder Internet-Verbindungen genutzt, welche Suchmaschinen mit welchen Begriffen benutzt, welche websites besucht und mit welchen Email-Empfängern kommuniziert? Mit dieser beispiellosen Vorratsdatensammlung ließe sich das Kommunikations- und Konsumverhalten einzelner Telekommunikationsnutzer heimlich ablesen - Verhaltens- und Kontaktprofile inklusive.
Auch die Pressefreiheit ist vor Otto Schily keineswegs sicher: So rechtfertigt er undifferenziert und hartnäckig die höchst umstrittene Durchsuchung der Redaktionsräume des Monatsmagazins "Cicero" und der Privatwohnung eines Journalisten durch das Bundeskriminalamt (BKA), zu der Schily die Ermächtigung erteilt hatte. Der Journalist hatte zulässigerweise aus einem geheimen BKA-Papier zitiert. Weil die undichte Stelle im BKA, also der Lieferant des Geheimdossiers, nicht zu finden war, wurde gegen den Journalisten wegen "Beihilfe zum Geheimnisverrat" ermittelt - stundenlange Razzien und kistenweise Beschlagnahme von Recherchematerial inklusive. Das gesuchte Dokument wurde nicht gefunden, dafür "Zufallsfunde" zuhauf, die mit dem Durchsuchungsanlass nicht das Geringste zu tun haben, aber zu weiteren Ermittlungsverfahren führten. Mit dieser Verdächtigung, als Journalist am Verrat von Dienstgeheimnissen selbst beteiligt gewesen zu sein, lassen sich Informantenschutz und Zeugnisverweigerungsrecht praktisch aushebeln - und damit das hohe Gut der Pressefreiheit. Solche Praktiken können letztlich dazu führen, kritische Journalisten einzuschüchtern und von investigativen Recherchen abzuhalten.
So sehen die fatalen Folgen aus, wenn man, wie der Preisträger, die Sicherheit zum Grundrecht kürt, wenn man die Staatsräson zum Verfassungsgrundsatz erhebt, die alles andere dominiert: Dann herrscht partielle Willkür, dann werden Bürgerrechte zur Makulatur. Angesichts überzogener Antiterrormaßnahmen und einer eskalierenden Sicherheitsdebatte warnte der frühere Datenschutzbeauftragte und Vorsitzende des Nationalen Ethikrates, Spiros Simitis, eindringlich: "Jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir am Grundbestand unserer verfassungsrechtlichen Vorgaben angelangt sind - der Übergang in eine totalitäre Gesellschaft ist fließend". Und der Soziologe Ulrich Beck sieht mit der "Risikogesellschaft", in der wir leben, ohnehin eine "Tendenz zu einem ,legitimen' Totalitarismus der Gefahrenabwehr" verbunden: Ausgestattet mit "dem Recht, das Schlimmste zu verhindern", schaffe sie in "nur allzu bekannter Manier das andere Noch-Schlimmere". Anstatt dieser fatalen Tendenz wirksam entgegenzutreten, betätigte sich Otto Schily als ihr missionarischer Vollstrecker. Selbst sein Ministerkollege Wolfgang Clement fand deutliche Worte für Otto Schilys freiheitsbegrenzendes Wirken, als er seine Zeit nach dem Ausstieg aus der Bundesregierung so skizzierte: "Ich bin ein freier Mensch und werde jetzt von meinen Freiheitsrechten Gebrauch machen - und zwar ausgiebig -, natürlich nur in dem Rahmen, den Otto Schily mir noch zur Verfügung stellt..." (WDR 10.10.2005).