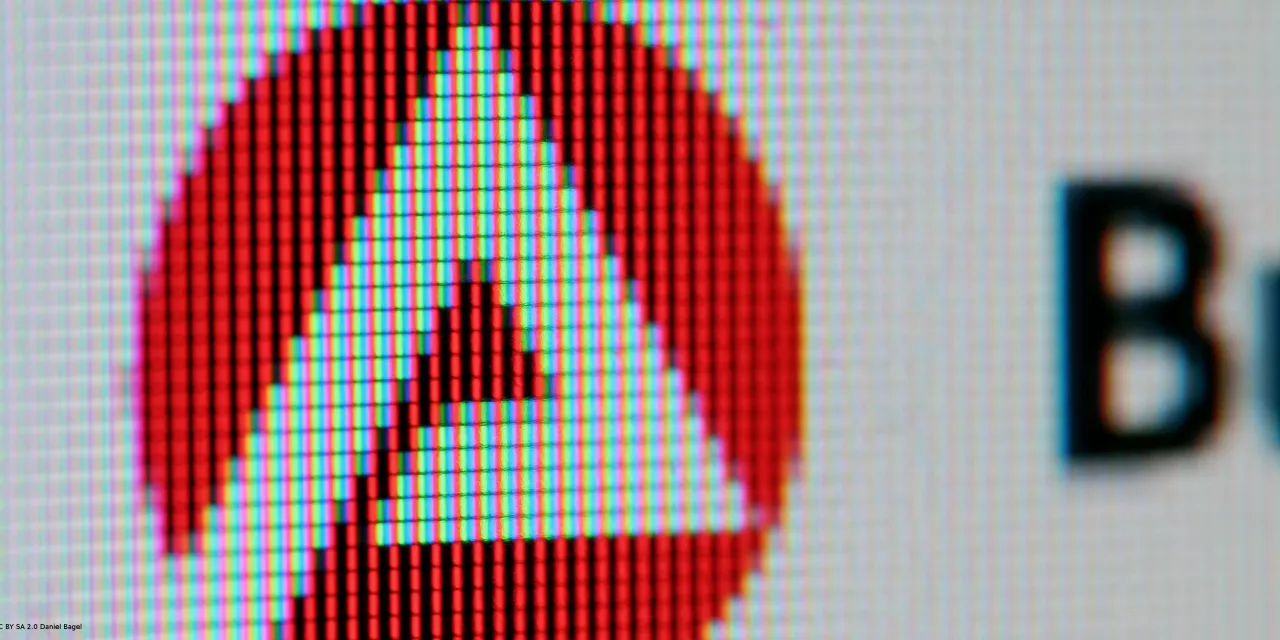Bundesländer

Der BigBrotherAward im Bereich Politik wird verliehen an die Regierungen/Innenminister der Bundesländer Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen, weil sie im Windschatten der Terrorismusbekämpfung die Verschärfung ihrer Landespolizeigesetze betreiben und damit drastische Einschnitte in elementare Grund- und Freiheitsrechte einer Vielzahl unverdächtiger Personen einkalkulieren. Bedroht sind insbesondere das Brief- und Fernmeldegeheimnis, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und damit das Recht auf freie Kommunikation ohne Angst vor Repressalien.
1.
In allen genannten Bundesländern soll die präventive Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) durch die Polizei legalisiert werden - also das vorsorgliche Abhören von Telefonen und Handys sowie das vorsorgliche Mitlesen von Faxen, SMS und Emails, ohne dass eine Straftat oder ein Anfangsverdacht vorliegen muss. Zur Begründung heißt es: Beim Abhören könnte sich ja der Verdacht auf eine Straftat ergeben, die dann verhindert werden könnte, so die Logik der Gesetzesmacher. Dabei sollen schon vage Anhaltspunkte ausreichen, um potentielle Störer "zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder bedeutende Sach- und Vermögenswerte" belauschen zu können; oder aber um Personen zu überwachen, "bei denen tatsächliche Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass sie zukünftig schwerwiegende Straftaten begehen" (Formulierungen der Entwürfe variieren).
Mit einer solchen Befugnis, wie sie bislang nur in Thüringen legalisiert ist, kann die Polizei die Telekommunikation von "vorverdächtigten" Personen im weiten Vorfeld eines Anfangsverdachts vorsorglich überwachen - selbst wenn rein zufällige und unverdächtige Kommunikationspartner wie Verwandte, Nachbarn, Arbeitskollegen und sonstige Bekannten von den Lauschaktionen betroffen werden. Zum Teil soll sogar die Kommunikation mit unverdächtigen Kontakt- und Vertrauenspersonen wie Rechtsanwälten, Abgeordneten, Ärzten, Journalisten, Psychotherapeuten oder Seelsorgern überwacht werden können - und zwar ungeachtet der besonderen Schweigepflichten, denen solche Personen unterliegen. Auf diese Weise wird das gesetzlich verankerte Zeugnisverweigerungsrecht von Berufsgeheimnisträgern ausgehebelt, ebenso wie wesentliche Elemente der Pressefreiheit: nämlich der Schutz von Informanten und das Redaktionsgeheimnis. Unabhängige Recherchen wären so nicht mehr zu gewährleisten.
Dass die Maßnahme von einem Amtsrichter angeordnet werden muss, ist kein ausreichender Schutz, wie die ausufernde Praxis der Telefonüberwachung zur Strafverfolgung zeigt. Denn es gibt bis heute keine Ermittlungskompetenz des Richters und keine gerichtliche Verlaufs- und Erfolgskontrolle solcher Überwachungsmaßnahmen. Schon gehört die Bundesrepublik allein in diesem Bereich mit jährlich über 15.000 abgehörten Telefonanschlüssen und Millionen von Betroffenen zu den weltweiten Spitzenreitern im Abhören - ein trauriger Rekord, der den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Jürgen Kühling dazu brachte, das Brief- und Fernmeldegeheimnis als "Totalverlust" abzuschreiben (Grundrechte-Report 2003, S. 15). Das Recht auf freie Kommunikation ohne Angst vor Überwachung und Repressalien ist nicht mehr garantiert.
2.
Die präventive Überwachung der Telekommunikation schließt neben der Inhaltskontrolle auch die näheren Umstände der Telekommunikation ein (Erfassung und Speicherung von Verbindungsdaten). Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienstleistungen erbringt oder auch nur daran mitwirkt, wird gesetzlich verpflichtet, der Polizei die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation zu ermöglichen: Zu diesem Zweck müssen sie die notwendigen technischen Voraussetzungen schaffen, um damit Unmengen von Überwachungsdaten auf Verdacht und Vorrat erfassen und speichern zu können. Die Diensteanbieter müssen der Polizei jederzeit Auskünfte über die näheren Umstände und Verbindungen früherer, aktueller und künftiger Telekommunikationsprozesse erteilen: Wer hat mit wem, wann und wie lange von wo nach wo fernmündlich oder schriftlich kommuniziert, welche SMS- oder Internetverbindungen genutzt.
3.
Auch die Standortfeststellung von Telekommunikationsteilnehmern mit Hilfe sog. IMSI-Catcher ist geplant. Einerseits können mit diesen schuhkartongroßen Geräten die individuellen Kennungen und Gerätenummern von Handys ausgeforscht werden. Aufgrund dieser Identifikation kann die Polizei dann Verbindungsdaten der Mobilfunkteilnehmer beim jeweiligen Telekommunikationsunternehmen abfragen. Andererseits können zur genauen Standortbestimmung Handys elektronisch geortet werden, auch wenn diese nur standby geschaltet sind. Dadurch wird der Polizei die Möglichkeit eröffnet, Bewegungsbilder ihrer Besitzer und Nutzer zu erstellen - nicht etwa zur Verfolgung von Straftätern, nein: zur Verfolgung von Personen, denen künftig Straftaten zugetraut werden (also zur Verfolgung von prinzipiell Unverdächtigen).
Die Bürgerrechtsorganisation "Humanistische Union" hat im Juli diesen Jahres vor dem Bundesverfassungsgericht Verfassungsbeschwerde gegen den Einsatz des IMSI-Catchers zum Zwecke der Strafverfolgung erhoben, der Anfang 2003 in der Strafprozessordnung legalisiert worden ist. Der IMSI-Catcher-Einsatz führe zur unterschiedlosen Erfassung gänzlich unverdächtiger Personen und verstoße deshalb gegen das Fernmeldegeheimnis des Art. 10 Grundgesetz, das auf diese Weise undifferenzierten Ermittlungsmethoden geopfert werde.
4.
In Rheinland-Pfalz ist der Einsatz von elektronischen Wanzen und Video-Kameras zum präventiven Großen Lausch- und Spähangriff in und aus Wohnungen geplant, wie er bereits in Thüringen (und Baden-Württemberg) legalisiert worden ist. Zur Installation der Lausch- und Spähwanzen soll die Polizei die auszuforschende Wohnung unerkannt betreten können. Damit kann das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung bereits im Vorfeld, ohne Vorliegen eines Straftatverdachts gegen die Eigentümer, Mieter, Mitbewohner oder Besucher ausgehebelt werden.
Der richterliche Beschluss zur Anordnung dieser Maßnahme ist nach jeweils dreimonatiger Aktion zu erneuern, ohne dass eine zeitliche Obergrenze vorgesehen ist. Bei Gefahr im Verzug soll - trotz der Schwere des Eingriffs - eine Anordnung durch den Behördenleiter ausreichen. Die besonderen Berufsgeheimnisse von zeugnisverweigerungsberechtigten Personen sind keineswegs ausreichend geschützt.
Nachdem inzwischen selbst die eigenen vier Wände objektiv nicht mehr vor Lauschangriffen sicher seien, so der frühere Bundesverfassungsrichter Jürgen Kühling, drohe "ein Zivilisationsverlust, der unsere Demokratie verändern wird" (Grundrechte-Report 2003, S. 20).
5.
In Bayern ist die automatische Erfassung von Auto-Kennzeichen und deren Abgleich mit Polizeidateien (Fahndungs- und sonstigem Datenbestand) geplant. Ergibt sich bei diesem Datenabgleich ein Verdacht, so wird das betreffende Fahrzeug verfolgt. Die bayerische Polizei testet bereits ohne jegliche Rechtsgrundlage entsprechende Systeme. Ob mit diesem Massenscreening nur Autokennzeichen oder auch andere, etwa biometrische Kennzeichen zum Zwecke der Gesichtserkennung erfasst und abgeglichen werden sollen, ist ebenso ungeklärt wie die Frage, was mit den erfassten Daten geschieht, ob sie etwa zur Erstellung von Bewegungsbildern und Reiseprofilen bestimmter Personen genutzt werden können.
Außer an den bayerischen Grenzen soll der automatische Kennzeichenabgleich auch an sogenannten gefährdeten Orten wie Flughäfen, Bahnhöfen und militärischen Einrichtungen erfolgen, darüber hinaus zur Überwachung von Straßen, Autobahnen, Einkaufszentren oder Parkplätzen. Vor Demonstrationen sollen auf diese Weise "bekannte Störer" ausgefiltert werden.
Fazit: Solche präventiven Regelungen sind in ihren Auswirkungen tendenziell uferlos, kaum kontrollierbar und daher unverhältnismäßig. In diesem zur Maßlosigkeit neigenden Präventionskonzept werden immer mehr unverdächtige Menschen polizeipflichtig gemacht und in Ermittlungsmaßnahmen involviert. Die zahlreichen Betroffenen merken in aller Regel nichts von den intensiven Eingriffen.
Wo die Prävention zur vorherrschenden Polizeilogik erhoben wird, da verkehren sich rasch die Beziehungen zwischen Bürger und Staat: Da verliert eine der wichtigsten rechtsstaatlichen Errungenschaften, nämlich die Unschuldsvermutung, unter der Hand ihre machtbegrenzende Funktion. Der Mensch mutiert zum (potentiellen) Sicherheitsrisiko - ein generalisiertes Misstrauensvotum, wie es schon bei der Schleier- und Rasterfahndung sowie bei der ausufernden Video-Überwachung im öffentlichen Raum zum Ausdruck kommt, in die alle Passanten einbezogen werden, ohne zu wissen, was mit den Aufzeichnungen anschließend geschieht.
Die neuen Instrumente machen einem präventiven Überwachungsstaat alle Ehre - einem Sicherheitsstaat, in dem Rechtssicherheit und ertrauen allmählich verloren gehen, Verunsicherung und Verängstigung gedeihen. Angesichts einer solchen Entwicklung gibt die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, zu bedenken:
"Eine demokratische politische Kultur lebt von der Meinungsfreude und dem Engagement der Bürger. Diese dürften allmählich verloren gehen, wenn der Staat seine Bürger biometrisch vermisst, datenmäßig durchrastert und seine Lebensregungen elektronisch verfolgt."
Im CDU-regierten Thüringen ist der Frontalangriff auf elementare Freiheitsrechte bereits im Juni 2002 umgesetzt worden. Insofern erhält die Thüringer Landesregierung den BigBrother Award für eine vollendete Tat. Diesem Pilotprojekt wollen nun Bayern (CSU), Niedersachsen (CDU/FDP) und Rheinland-Pfalz (SPD/FDP) folgen. Deshalb erhalten die dafür Verantwortlichen den Preis präventiv - sozusagen als Maßnahme der Gefahrenabwehr.
Herzlichen Glückwunsch an die Regierungen und Innenminister von Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thüringen.
Laudator.in