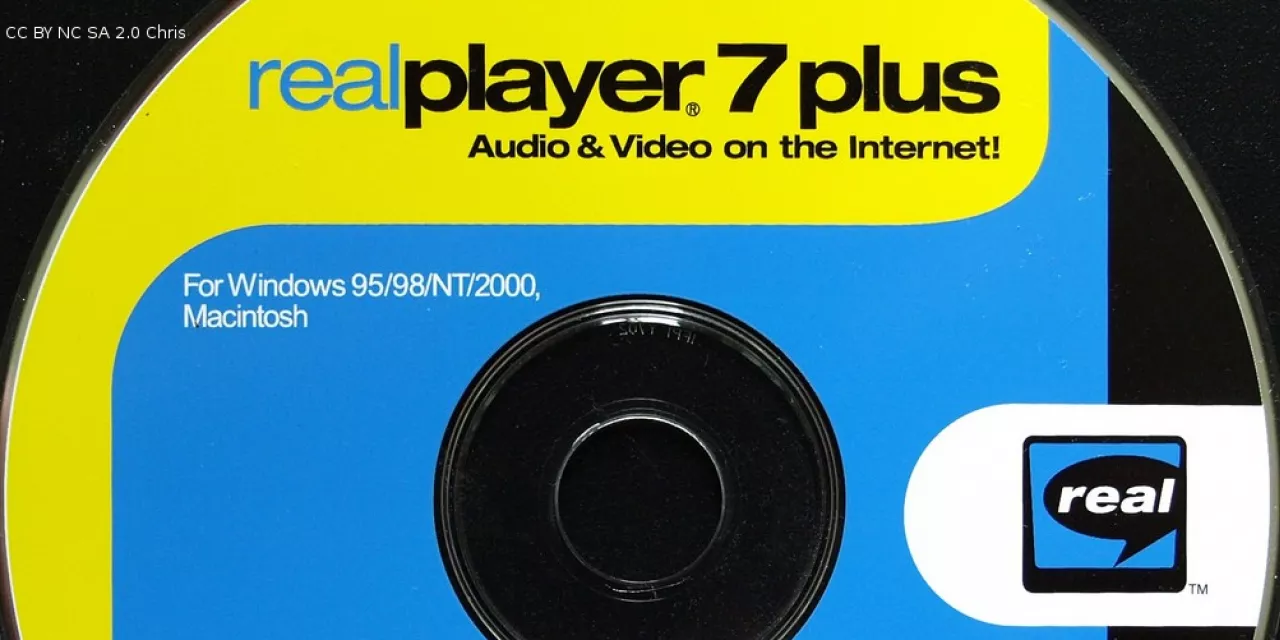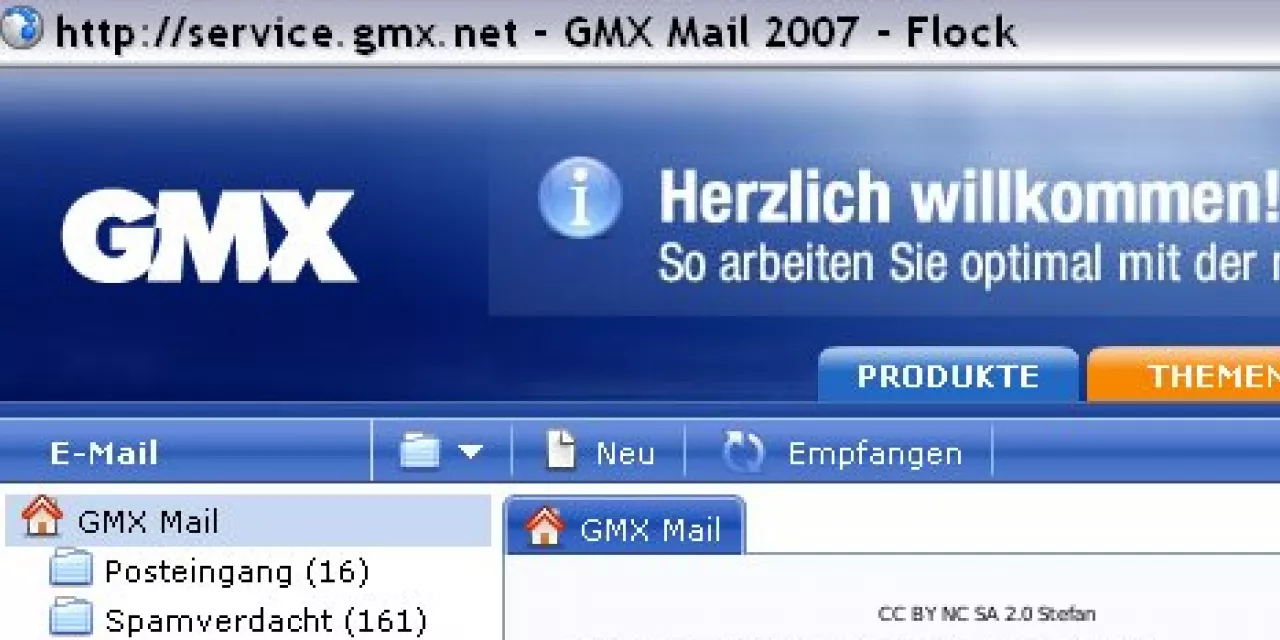Hintergrund zu 3-S-Zentralen:
http://www.is-kassel.de/%7Esafercity/2000/der_deutsche_bahnhof.html [Link nicht mehr verfügbar]
von Volker Eick (Berlin), Mai 1998
Der deutsche Bahnhof - Zentrale oder Filiale der panoptischen Stadt des 21. Jahrhunderts?
Aktuelle Sicherheitsdiskussionen, -strategien und -praxen bei und im "Umfeld" der Deutschen Bahn AG
Papier, vorgestellt auf dem Treffen der Innenstadt-AG, Frankfurt/M. (5. Mai 1998, Frankfurt/M.)
1 Einleitung
2 Bahnpolizei & Bundesgrenzschutz
3 Bundesgrenzschutz & 'Aktion Sicherheitsnetz'
4 Bundesgrenzschutz & Bahnanlagen
5 Deutsche Bahn AG & "3-S-Konzept"
6 Berlin, Bahn & "Umfeld"
7 Literaturauswahl
1 Einleitung
Im folgenden möchte ich auf drei Aspekte eingehen, die in dem vorhergehenden Beitrag und den Videos bereits angesprochen wurden.
* Der erste wichtige Aspekt ist die Rolle, die der Bundesgrenzschutz (BGS) seit der Privatisierung der Deutschen Bundes- und Reichsbahn zur Deutschen Bahn AG (1992) spielt. Diese neue Rolle ist im "Gesetz zur Übertragung der Aufgaben der Bahnpolizei und der Luftsicherheit auf den Bundesgrenzschutz" fixiert, das seit dem 1. April 1992 gilt. Denn damit sind zwei grundlegende Veränderungen verbunden: Erstens untersteht die Bahnpolizei des Verkehrsunternehmens "Deutschen Bahn AG" nicht mehr dem Bundesverkehrsministerium, sondern ist Teil der Strukturen des Bundesinnenministeriums geworden. Damit geht zweitens eine Ausweitung der Befugnisse und die verstärkte Präsenz des Bundesgrenzschutzes im Landesinneren einher, der sich so jenseits aller verfassungsrechtlichen Bedenken mehr und mehr sogenannte allgemeinpolizeiliche Aufgaben angeeignet hat. Mit den auf der Innenministerkonferenz (IMK) im Februar 1998 vereinbarten Regelungen zur "Aktion Sicherheitsnetz" konnte sich so ein bereits 1988 vom Bundesinnenministerium entwickeltes Organisationskonzept für den Bundesgrenzschutz weitgehend durchsetzen.
* Der zweite Aspekt betrifft das 1994 vom "Geschäftsbereich Personenbahnhöfe" entwickelte "3-S-Konzept": Service, Sicherheit, Sauberkeit. Hier konzentriere ich mich auf das "S" für "Sicherheit", das mit dem Aufbau eines betriebseigenen Sicherheitsdienstes, der "Bahn Schutz & Service GmbH", einher ging und explizit auch das Bahnhofsumfeld den Kontrollinteressen der Deutschen Bahn AG zuschlägt. Neben dem betriebseigenen Sicherheitsdienst sind weitere private Sicherheitsdienste, die jeweiligen Landespolizeien und der Bundesgrenzschutz in verschiedenen "Sicherheitsstäben" zusammengefaßt. Integraler Bestandteil ist zudem die Aufrüstung der Bahnhöfe mit den eben im Film gesehenen "3-S-Zentralen".
* Im dritten Teil will ich anhand einiger Zahlen und Erfahrungen die konkrete Praxis in Berlin skizzieren.
2 Bahnpolizei & Bundesgrenzschutz
Bis 1992 hatte der BGS zwei Aufgaben, die er fast ausschließlich in geschlossenen und kasernierten Verbänden erfüllte: Die Grenzsicherung und die Unterstützung auf Anforderung der Landespolizeien bei "besonderen Lagen", wie Großdemonstrationen und in der "Terrorismus"bekämpfung. Gesetzlich gedeckt ist auch der Einsatz "im Falle des inneren Notstandes" und in Katastrophenfällen.
Bereits Mitte der 80er Jahre beginnt das Bundesinnenministerium der prognostizierten Verminderung von Aufgaben beim Bundesgrenzschutz mit verschiedenen Untersuchungen entgegenzuwirken. Zu diesem Zeitpunkt entsteht so das Papier "BGS 2000. Aufgaben und Gestaltung des BGS als Polizei des Bundes über das Jahr 2000 hinaus" (Kessow 1997: 29). 1988 wird eine interministerielle Arbeitsgruppe gegründet und 1990 der Abschlußbericht dieses Untersuchungsausschusses vorgelegt, der noch nicht auf die grundlegende und mittlerweile beschlossene Reform des BGS abhebt. Ab dem 3. Oktober 1990 wird dem Bundesgrenzschutz in den neuen Ländern die Aufgaben der Bahnpolizei (die dort "Trapo", also Transportpolizei, hieß) übertragen; diese Regelung galt sofort auch für Westberlin.
Das Bundesministerium für Verkehr und Bundesministerium des Innern einigten sich sodann, daß im Anschlußgebiet (also auch in Westberlin) von nun das Bundesinnenministerium zuständig sei, während im übrigen Bundesgebiet der Bundesminister für Verkehr zuständig bleibt. Mit dem sog. "Aufgabenübertragungsgesetz" vom April 1992 ist der BGS dann für die gesamte BRD zuständig. Mit dieser Aufgabenübertragung wirkt der Bundesinnenminister - vorerst endgültig - einer befürchteten Truppenreduzierung u.a. durch die Neuschaffung des einzeldienstlichen Aufgabenfeldes "Bahnpolizeiliche Aufgaben" entgegen (Kessow 1997: 19ff). Der Wegfall der innerdeutschen Grenze und die sich abzeichnenden Lockerungen an den Schengener Binnengrenzen konnten so personalpolitisch erfolgreich abgefangen werden.
Die von Bundesinnenminister Manfred Kanther (CDU) im September 1997 beschlossene Neuorganisation des Bundesgrenzschutz sieht neben den ca. 13.000 kasernierten Bundespolizeikräften den Ausbau der einzeldienstlichen Aufgabenfelder für 18.600 Kräfte vor: Grenzpolizeiliche Aufgaben, bahnpolizeiliche sowie Luftsicherheitsaufgaben und der polizeiliche Schutz von Bundesorganen sind nun die vier einzeldienstlichen Aufgabenfelder des BGS. Dem bahnpolizeilichen Einzeldienst werden 5.540 Kräfte zugewiesen (1997), was einem Zuwachs von 20 Prozent binnen Jahresfrist entspricht (Bundesministerium des Innern 1997: 3ff; Eick 1998: 101). Weitergehend ist nur noch die Aufstockung an der Ostgrenze der Bundesrepublik; hier wurden die BGS-Truppen von 2.000 (1992) auf 7.000 (1994) verstärkt, so daß dort insgesamt 11.000 Beamte im Einsatz sind. Europaweit stellt damit die deutsche Ostgrenze das Gebiet mit der höchsten Polizeidichte im gesamteuropäischen Vergleich dar (vgl. Berliner Behörden Spiegel 1998: 5).
3 Bundesgrenzschutz & 'Aktion Sicherheitsnetz'
An dieser Stelle greift dann der Beschluß der Innenministerkonferenz vom Februar 1998 über eine "Partnerschaft für mehr Sicherheit in unseren Städten und Gemeinden". Das von Innenminister Kanther in diesem Zusammenhang initiierte "großstädtische Modellvorhaben in der 'Aktion Sicherheitsnetz'" wird weitgehend übernommen. Berlin ist eine der auserkorenen Modellstädte. Allerdings findet der Begriff "Sicherheitsnetz" keine Anwendung mehr, sondern es wird von "Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften", von einer "partnerschaftlich vernetzten Kooperation" gesprochen (IMK-Beschluß 1998: 5).
Folgende Maßnahmen sind in der "Aktion Sicherheitsnetz" vorgesehen: konsequente Verfolgung von Bagatellkriminalität wie Ladendiebstahl und Graffiti, entschlossene Verteidigung der öffentlichen Ordnung gegen "z.B. aggressives Betteln, Lärmen, Verunreinigung öffentlichen Verkehrsraums u.a." (IMK-Beschluß 1998: 5), engste Zusammenarbeit von Polizei, Bundesgrenzschutz, Ordnungsbehörden, Sozialversicherungen, Arbeits-, Jugend- und Sozialämtern, Kooperation mit privaten Sicherheitsdiensten und freiwilligen Polizeihelfern, Mitwirkung der Justiz mittels Hauptverhandlungshaft und beschleunigten Verfahren, Bürgernahe, dezentralisierte Polizei und Schaffung von Präventionsräten auf kommunaler Ebene.
Ohne hier ins Detail des Innenministerbeschlusses gehen zu wollen, doch fünf Anmerkungen:
Erstens geht der Beschluß der Innenministerkonferenz in Teilen über die Forderungen von Kanther hinaus: So werden überwachter Hausarrest, mehr Haftplätze, geschlossene Heimunterbringung für Jugendliche und verschärftes Vorgehen gegen MigrantInnen gefordert (vgl. IMK-Beschluß 1998: 6f).
Zweitens haben - mit Ausnahme von Hamburg - alle Bundesländer der Forderung des Bundesinnenministeriums nach verdachts- und ereignisunabhängigen Kontrollen durch den BGS auch außerhalb des Grenzbereiches (der ja im Rahmen der "Schleierfahndung" ohnehin 30 Kilometer in das Landesinnere verlegt wurde) zugestimmt.
Drittens haben ihre Bereitschaft, am Modellversuch "Sicherheitsnetz" teilzunehmen, bereits die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz signalisiert. Für Berlin und Stuttgart wurden bereits Abkommen über den BGS-Einsatz unterzeichnet. Bremen, Hessen für die Region Frankfurt am Main mit Offenbach und Hanau sowie Hessen gemeinsam mit Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für den Rhein-Neckar-Raum (Mannheim, Ludwigshafen, Viernheim und Lampertheim) haben gegenüber dem BMI ihre Teilnahmeabsicht erklärt. In den beiden Süd- West-Regionen ist als Starttermin Ende März/Anfang April vorgesehen. Darüber hinaus sind die Städte Hannover (zur EXPO 2000) und München für eine Beteiligung am 'Sicherheitsnetz' im Gespräch (vgl. Kant/Pütter 1998: 73).
Viertens hat eine weitere Bundesbehörde - unabhängig vom "Sicherheitsnetz" -, die 'Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll' (ZUZ) beim Kölner Zollkriminalamt, am 1. Januar 1998 ihre Arbeit aufgenommen. Die ZUZ, die dem Bundesfinanzminister untersteht, soll eingesetzt werden, wenn die Lage ein geschlossenes Vorgehen - offen oder verdeckt - unter Anwendung unmittelbaren Zwanges gegen Gewalttäter erfordert. (vgl. Berliner Behörden Spiegel 1998: 5). Der Personalbestand sämtlicher Zollbehörden beläuft sich auf 38.848 Beamte. 6.100 bei der Grenzkontrolle, 3.100 bei der Zollfahndung in 34 Fahndungskommissariaten (ebenda).
Fünftens spielen Verkehrswege und -knoten für das nationale Netz der Inneren Sicherheit und bei der Kontrolle der nach innen verlängerten Grenzen eine zentrale Rolle. Strategische Orte stellen darin Autobahnen, Flughäfen, Fernverkehrszüge und Bahnhöfe, zentrale Regionen die jeweiligen Grenzregionen dar (vgl. Maurer 1998: 51ff, der in Hinblick auf die "Schleierfahndung" von einer "zweiten Grenzlinie" spricht).
Zusammengefaßt können die Anstrengungen von Bundesinnenminister Kanther im Zusammenhang mit der 'Aktion Sicherheitsnetz' und die weitgehende Zustimmung der Innenministerkonferenz vom 2. Februar 1998 als erfolgreiche Durchsetzung einer "Gefahrenabwehrverordnung des Bundes" bezeichnet werden. Während die lokalen Sicherheits- und Ordnungspartnerschaften im städtischen und regionalen Raum organisiert werden und "problem- und projektbezogene Arbeit" leisten sollen (IMK-Beschluß 1998: 4), erschließt das zweite Kontrollnetz der inneren Grenzen flächendeckend den nationalen Raum.
4 Bundesgrenzschutz & Bahnanlagen
Die Aufgaben des BGS auf den Bahnanlagen (Bahnhöfe, Gleisanlagen, Versorgungseinrichtungen, aber auch Bahnumfeld) lassen sich in drei Punkten zusammenfassen (vgl. Kessow 1997: 19ff, 82f):
a.Abwehr von Gefahren, die vom Betrieb der Eisenbahnen ausgehen (also Abwehr von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die den Benutzern, den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen; vgl. § 3 BGSG; Kessow 1997: 77),
b.Überwachung der öffentlichen Ordnung mittels Übertragung des Hausrechts. Die Übertragung des Hausrechts rechtfertigt sich jedoch nur aus Sondersituationen bis zum Eintreffen der zuständigen Stellen (vgl. § 1 Abs. 4 BGSG; Kessow 1997: 81f; Bueß (1997: 200) sieht demgegenüber keine Übertragung des privatrechtlichen Hausrechts an den Bundesgrenzschutz). Im Zusammenhang mit dem Einsatz privater Sicherheitsdienste ist zudem umstritten, ob das Hausrecht der Bahn AG auch privatrechtlicher oder rein öffentlich-rechtlicher Natur ist; das Bundesbahnvermögen war als nichtrechtliches Sondervermögen des Bundes hoheitsrechtlich verankert, wird aber jetzt privatrechtlich ausgeübt (vgl. Bueß 1997: 199f); jedenfalls spart die Bahn AG nach eigenen Angaben mit der Übertragung des Hausrechts an den BGS jährlich allein 240 Millionen Mark an Personalkosten ein,
c.Verfolgung von Zuwiderhandlungen auf dem gesamten Bahngelände und dessen Umfeld im Zuge des "ersten Angriffs" (Polizeidienstverordnung PDV 100, zit.n. Kessow 1997: 83).
Der Polizist und Polizeifachmann Kessow (1997: 77ff) spricht daher zusammenfassend von folgenden sachlichen Zuständigkeiten: Gefahrenabwehr, Erforschung von Straftaten, Erforschung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie Schutz privater Rechte, zu der die vorübergehende Wahrnehmung des Hausrechts zählt. Die bis 1992 von den bahnpolizeilichen Dienststellen geführte "Verbotsdatei", in der alle Personen gespeichert werden, die sich Anweisungen der damaligen Bahnpolizei nach dem Hausrecht widersetzt haben - und hier abgestuft nach Bahnhofsverweis, Bahnhofsverbot und Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs gespeichert sind -, gilt bspw. jetzt als privatrechtliche Datei und muß - aus Datenschutzgründen (J!) - der Deutschen Bahn AG zur weiteren Verwendung übergeben werden (Kessow 1997: 81f).
Diese Aufgabenbeschreibung des BGS stellt somit zunächst eine Verknüpfung von staatlicher Strafverfolgung und Hausrecht dar, wird aber durch die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten erweitert. Die Übertragung des Hausrechts an den BGS schafft die Möglichkeit, bereits "niedrigschwellig", also vor Auftreten einer Ordnungswidrigkeit oder Straftat, einzuschreiten. Mit dem Bundesgrenzschutzgesetz (BGSG) von 1992 wird dem BGS auch die Aufgabe übertragen, zur "Verhütung von Straftaten", also präventiv, einzugreifen. Dieser Präventionsauftrag stellt damit die Grundlage für den BGS dar, jenseits strafrechtlicher Relevanz zur Steigerung des "subjektiven Sicherheitsgefühls" tätig zu werden. Hier liegt auch die zentrale Verknüpfung mit den zahlreichen Gefahrenabwehrverordnungen, Präventionsratsmodellen und Sicherheitspartnerschaften, die sich auf Länder- und kommunaler Ebene etabliert haben.
Um noch einen eher nebensächlich wirkenden Aspekt zum Thema "Hausrecht" herauszugreifen: Die Übertragung des Hausrechts an den BGS und damit dessen Zuständigkeit für z.B. den noch immer als Straftatbestand gehandelten § 265a StGB (Beförderungserschleichung durch ein Verkehrsmittel, sog. "Schwarzfahren"). Im Kern stellt die Übertragung von Ordnungs- und betriebswirtschaftlich gewollten Aufgaben an den Bundesgrenzschutz einen klassischen Fall der Sozialisierung von Verlusten und Privatisierung von Gewinnen dar. Das gilt im übrigen analog für das Outsourcing der Fahrscheinkontrollen an (betriebsfremde) private Sicherheitsdienste im ÖPNV: In beiden Fällen haben die Verkehrsunternehmen ihre Kosten für die Durchsetzung ihrer Beförderungsentgelte durch die Drohung mit und die Inanspruchnahme von strafrechtlichen Sanktionen übertragen (Beförderungserschleichung). Es entstehen ihnen ja keine aus generellem strafrechtlichen Präventionsinteresse motivierten Kosten, sondern aus rein betriebswirtschaftlichem. In 1992 wurden etwa 70.000 Strafverfahren nach § 265a StGB eingeleitet; in Einzelfällen verbrachten dabei Menschen innerhalb der vergangenen zehn Jahre dreieinhalb Jahre nur wegen "Schwarzfahrens" im Gefängnis (vgl. Martin 1995: 341ff).
Ideologisch sind "Organisierte Kriminalität" und das "subjektive Sicherheitsgefühl" zu zentralen Schnittstellen für nationalstaatliche und kommunale Aktivitäten im Sicherheitsbereich geworden; unterfüttert durch den "Sauberkeitsdiskurs", der in Berlin inzwischen auch seinen institutionalisierten Niederschlag in der "Aktion Saubere Hauptstadt" gefunden hat (vgl. Eick 1998; Kaufmann 1973).
Auf der räumlichen Ebene bilden Innenstädte und Bahnhöfe die zentrale Schnittstelle für nationalstaatliche und kommunale Sicherheitsanstrengungen; sie sind damit zugleich auch die Schnittstelle zwischen privaten und staatlichen Anstrengungen in diesem Bereich.
Auf der Akteursebene ist der BGS zum zentralen Knotenpunkt zwischen Landespolizeien, Ordnungsbehörden, privaten Akteuren (wie Verkehrsbetrieben, Einzelhandelsverbänden und Großkonzernen), aber auch sozialen Organisationen geworden, die sich z.T. bereitwillig in dieses Ausgrenzungsregime integrieren lassen. Private Sicherheitsdienste haben sich mittlerweile von ihren staatlichen oder privaten Auftraggebern soweit weitgehend emanzipieren können, daß sie eigenständig Forderungen aufstellen oder Vorschläge unterbreiten.
In der BGS-Praxis in Zusammenhang mit und in Abgrenzung zu den Tätigkeitsbereichen der Landespolizeien und Sicherheitsdienste ist es, so einhellig die Polizeifachliteratur, "eher eine Frage der praktischen Handhabung und weniger der rechtlichen Zuständigkeitsabgrenzung, ob und inwieweit die Landespolizei sich in diesen Bereichen auf die Präsenz des Bundesgrenzschutzes einrichtet und ihm nach Maßgabe der bestehenden landesrechtlichen Regelungen in Fällen ihrer originären Zuständigkeiten den "ersten Angriff" überläßt. Hierfür bieten sich (...) örtliche Absprachen an" (Kessow 1997: 83, Hervorh. im Original).
"Soweit private Sicherheitsdienste vertraglich verpflichtet werden, in zumutbarem Rahmen auf der Basis der Notrechte [d.s. die sog. "Jedermannrechte", V.E.] bei akuten Ereignissen einzugreifen, bestehen auch dagegen keine Bedenken: Die Deutsche Bahn AG schützt als juristische Person des Privatrechts den Betriebsablauf im Zusammenhang mit ihren Beförderungsleistungen" (Bueß 1997: 200).
Mithin ist also auf juristischer wie alltagspraktischer Ebene den jeweiligen Akteuren sehr weitgehend freie Hand in der Umsetzung ihrer Interessen gelassen.
5 Deutsche Bahn AG & "3-S-Konzept"
Strategisches Marketingkonzept der Bahn AG als Immobilienunternehmen und Verkehrsdienstleister ist das 1994 installierte "3-S-System" ("Service, Sicherheit, Sauberkeit"), in das in den nächsten Jahren drei Milliarden Mark investiert werden sollen. Zu den Normalitäts- und Konformitätsvorstellungen, die darin verankert sind, wird später noch einiges gesagt werden; auch zur Service-Kultur und Hygiene in Bahnhöfen, die bei "durch den Kunden reklamierte[n] Verschmutzungen", je nach Bahnhofs-Kategorie, "innerhalb von 15 Minuten" oder "innerhalb von 24 Stunden beseitigt werden sollen" (Deutsche Bahn AG 1996: 15).
Daher will ich mich hier auf die dritte Säule, das "S" für "Sicherheit", konzentrieren, das seinerseits auf dem Ausbau der technischen Infrastruktur, also den Videoüberwachungszentralen und ihren mobilen Gegenstücken, sowie der "Bahn Schutz & Service GmbH" (BSG) fußt. Dabei wird der Geschäftsbereich bis Ende 1999 vierzig stationäre "3-S-Zentralen" mit einem Gesamtvolumen von 250 Millionen Mark errichten, die rund um die Uhr von Mitarbeitern der Deutschen Bahn AG und des Bundesgrenzschutzes besetzt sein werden. Seit Mai 1995 ist Mainz mit einer solchen Anlage ausgerüstet, auch in Nürnberg und weiteren Städten gibt es sie bereits. Weitere 1.000 Bahnhöfe werden in den folgenden Jahren an diese Sicherheitszentralen angeschlossen; z.T. als Verbundschaltungen über Videokameras und mobile "3-S-Zentralen" in größere Überwachungseinheiten integriert. Zur Refinanzierung der Kosten, so der "Geschäftsbereich Personenbahnhöfe" weiter, "soll eine teilweise Vermarktung der 3-S- Zentralen durch die Aufschaltung privater Haushalte und Gewerbeanlagen dienen" (Deutsche Bahn AG 1996: 17).
Die BSG verdankt ihre Existenz dem Bundeskartellamt. Das nämlich lehnte die Beauftragung eines privaten Sicherheitsunternehmens durch die Deutsche Bahn AG ab, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhüten. Angesichts der Tatsache, daß derzeit 1 Prozent aller privaten Sicherheitsdienste über 50 Prozent des Umsatzes realisieren, ist das ein wenig rührend. Mit anderen Worten: 14 Sicherheitsdienste (von etwa 1.500) kontrollieren 57 Prozent des Marktes (vgl. Eick 1998). Die "Bahn Schutz GmbH" ist 100prozentige Tochter der "dvm Deutsche Verkehrsdienstleistungs- und -management GmbH", die wiederum 100prozentige Tochter der Deutschen Bahn AG ist. Die BSG ist immanenter Bestandteil der seit 1994 gültigen Sicherheitsdoktrin der Deutschen Bahn AG, dem "3-S- Konzept". Zu Beginn des Jahres 1995 waren 84 Mitarbeiter, Ende 1995 bereits 800 Personen beschäftigt. Ende 1996 waren bundesweit bereits 2.000 Personen bei der "Bahn Schutz GmbH" in (Niedrig)Lohn und Brot (vgl. Wiedenroth 1995: 25; Deutsche Bahn AG 1996: 49; BSG 1997). Zeitgleich hat die Deutsche Bahn AG 30.000 MitarbeiterInnen entlassen.
In ihrem letzten Geschäftsbericht (Deutsche Bahn AG 1997a) weist die Bahn AG keine gesonderten Zahlen für die BSG mehr aus, sondern faßt sie in den Beschäftigtenzahlen der "dvm-gruppe" zusammen, die aus sieben Reinigungsfirmen und der "Bahn Schutz GmbH" besteht (1996: 13.271 MitarbeiterInnen). Mit ihrer Hausrechtsanwendung wirbt die "Bahn Schutz GmbH" auch in eigenen Broschüren. So heißt es unter der Überschrift "Beschützender Kundendienst mit den 3 S": "Etwa 65.000 Hausrechtsmaßnahmen, 800 Strafanzeigen und rund 500 vorläufige Festnahmen pro Monat auf deutschen Personenbahnhöfen sind ein Beleg dafür, daß wir im Zweifel Ernst machen" (BSG 1997: 4f). Die BSG arbeitet nach Hausrecht und Gewerbeordnung und übt "Jedermannrechte" aus. Darunter fällt das Notwehrrecht, was oft so ausgelegt wird, daß gegen jemanden, der einen Platzverweis erhält und sich dagegen wehrt, mit Gewalt vorgegangen werden darf. Anders als die Polizei unterliegen private Sicherheitsdienste hier nicht dem Gebot der Verhältnismäßigkeit. Sie unterliegen auch keinen Einschränkungen beim Einsatz von z.B. Überwachungskameras. In der Praxis findet ein reger Datenaustausch zwischen Privaten und Polizei statt, nicht zuletzt durch personelle Verbindungen im Rahmen sog. "Old Boy Networks" zwischen ehemaligen Polizisten und ihren alten Kollegen.
In Städten wie Hamburg oder Berlin finden nach Zahlen von 1994/95 bis zu 70 bzw. 55 Prozent aller Platzverweise ausschließlich in Bahnhöfen bzw. deren Umfeld statt. Private Sicherheitsdienste, wie in Berlin beispielsweise der "B.O.S.S. Sicherheitsdienst", sind Teil dieser Strukturen. Zwei Immobilienspekulanten und Betreiber von Nobelhotels sowie "Läusepensionen" führen den "B.O.S.S. Sicherheitsdienst", der mittlerweile von der Vertreibung aus Bahnhöfen über die Bewachung von Obdachlosen und Obdachlosenheimen bis zum Management von Flüchtlingslagern und der Abschiebevorbereitung ein umfassendes "Deportationsmanagement" betreibt (vgl. Eick 1998).
Die "Bahn Schutz GmbH", der BGS, die Berliner bzw. Brandenburger Landespolizei sowie der "Stab Bahnsicherheit" der Berliner S-Bahn halten regelmäßige Koordinierungstreffen ab. Die Berliner "S-Bahn GmbH" ist ebenfalls eine 100%ige Tochter der Deutschen Bahn AG und spricht, ähnlich wie ihre Muttergesellschaft von Fernbahnhöfen, von den S-Bahnhöfen als "Visitenkarten" bzw. "Headquarters" (S-Bahn Berlin 1998: 12, 22).
6 Berlin, Bahn & "Umfeld"
In einem Hintergrundpapier der Senatsverwaltung für Inneres zur Teilnahme an der "Aktion Sicherheitsnetz" (1998) werden für Berlin die verschiedenen Initiativen der Senats- und Bezirksverwaltungen, der Polizei, des Bundesgrenzschutzes, der mobilisierten Bevölkerung (in Präventionsräten und Bürgerwehren) und der Privatwirtschaft dargestellt und aufeinander bezogen, wobei insbesondere die Einbindung der bezirklichen Ordnungsbehörden verstärkt werden soll. Hier werden sogenannte "Maßnahmestrategien" entwickelt, von denen das "Berliner Modell" - das heißt die verstärkte Einbindung der Schutzpolizei in die Kriminalitätsbekämpfung zur Entlastung der Kriminalpolizei - ein zentraler Baustein ist. Mit Einführung des "Berliner Modells" in den Bezirken Kreuzberg und Neukölln (Direktion 5) im Februar 1998 hat sich die Präsenz uniformierter Schutzpolizeikräfte auf den Straßen dieser Bezirke, unterstützt durch die "Freiwillige Polizeireserve" (FPR), ebenso spürbar erhöht wie das Anzeigeaufkommen. Zu den weiteren Maßnahmestrategien gehört auch die Anschaffung moderner Informations- und Kommunikationstechnik, eine durch Unternehmensberatungen gesteuerte Polizeistrukturreform und die "anlaß- und täterorientierte Bildung von Operativen Gruppen".
Zentraler Ansatzpunkt ist das "Herabsetzen der polizeilichen Einschreitschwelle für "die kleineren und unbedeutenden Verstöße" (Ordnungswidrigkeiten), "Hinsehen statt Wegschauen" bedeutet die Maxime, also ein Tätigwerden, wann immer es möglich erscheint, ohne die gesetzlichen Prioritäten auszuhebeln" (Senatsverwaltung für Inneres 1998: 2).
Teil dieser Strategie ist es auch, "Sicherheitsinitiativen privater Träger mit Know-how der Polizei zu unterstützen, z.B. [Unterstützung, V.E.] von Hausrechtsinhabern beim Einsatz von Videotechnik und privaten Sicherheitsdiensten" (ebenda: 3).
Ich möchte diese Strategien anhand von zwei Beispielen skizzieren: So gibt es in Berlin mittlerweile zwei sogenannte "Gemeinschaftsaktionen", die Gemeinschaftsaktion "Saubere Stadt Berlin" und die Gemeinschaftsaktion "Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen". In beiden Fällen wird, und darauf fehlt in dem Papier der Senatsverwaltung jeder Hinweis, auf private Sicherheitsdienste und - im Zuge intensivierter "Workfare"-Programme - auf SozialhilfeempfängerInnen und Langzeitarbeitslose, aber auch auf Schulkinder zurückgegriffen. So sind an der Gemeinschaftsaktion "Saubere Stadt Berlin" auf Initiative der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie (SenStadtUmTech) die Senatsverwaltungen für Gesundheit und Soziales (SenGesSoz), für Inneres (SenInn), für Wirtschaft und Betriebe (SenWiB), für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen (SenArbFrau), die Senatskanzlei (Skzl), die S-Bahn GmbH, die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), die Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), das Landeseinwohneramt (LEA), die Polizei, der Bundesgrenzschutz (BGS), das Landesschulamt und die Berliner Kraft- und Licht AG (BEWAG) beteiligt. SozialhilfeempfängerInnen müssen Straßen- und Parkreinigungen übernehmen, Schulkinder werden in den Wald zum Müll sammeln geschickt, Langzeitarbeitslose über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) bei privaten Sicherheitsdiensten für die Vertreibung von Obdachlosen und Junkies eingestellt. Das gilt analog auch für die Gemeinschaftsaktion "Sicherheit und Sauberkeit auf Bahnhöfen"; hier arbeiten neben den genannten Senatsstellen noch die Senatsverwaltung für Justiz (SenJust) für das sofortige Abstrafen von "Verunreinigern" und "Störern", das Bundesinnenministerium, das Innenministerium des Landes Brandenburg, die Deutsche Bahn AG, die "Landeskommission Berlin gegen Gewalt" und die Berliner Feuerwehr zusammen (Senatsverwaltung für Inneres 1998: 3). Der Innensenat betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich, daß bei "Sauberkeit" wie auch bei "Sicherheit" das Land Berlin "von den guten Kontakten des BGS zur S-Bahn Berlin GmbH und des LKA zur BVG" profitiert, die jeweils als Bindeglieder fungieren (ebenda: 6).
Da Berlin seit November 1997 Modellstadt für die intensivierte Zusammenarbeit mit dem Bundesgrenzschutz ist, wurde eine gemeinsame Koordinierungsstelle der Polizei Berlin und des Grenzschutzpräsidiums Ost (GSP), die sogenannte "Koost BGS/Polizei", eingerichtet, die gemeinsame Fortbildungen, Schwerpunktmaßnahmen, intensivierten Datenaustausch, gemeinsame Streifentätigkeit und den Aufbau gemeinsamer Fahndungs- und Ermittlungsgruppen koordiniert (ebenda: 4f). Hierzu zählen u.a. zwei "Ermittlungsgruppen Schleuser" (seit Oktober 1994 bzw. August 1997), die "Ermittlungsgruppe Wertzeichenfälschung" (seit Dezember 1997) und die "Gemeinsame Ermittlungsgruppe Graffiti in Berlin" (EG GiB, seit 1995), die aus elf BGS-Beamten und 25 Schutzpolizisten besteht und durch eine eigene "Operative Gruppe Graffiti" mit sechs BGS- und acht Landespolizeibeamten unterstützt wird. "Operative Gruppen" nach ethnischen oder Delikt-Kategorien gibt es auch bei der Landespolizei, und die Zielvorstellungen des Berliner Senats gehen dahin, diese mit den BGS-Einheiten zu verschmelzen sowie die Zusammenarbeit von Schutz- und Kriminalpolizei, von Polizei und Ordnungsbehörden mit den privatwirtschaftlichen Aktivisten zu intensivieren.
Neben diesen Reorganisationsbemühungen des Sicherheitsapparates sind zwei Ordnungsgesetze die zentralen Hebel im Rahmen der praktizierten Ausgrenzung:
Dazu gehört die von den Bezirksämtern zu definierende "Ausführungsvorschrift über die Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes", die bisher z.B. der Polizei den Platzverweis nur dann ermöglichte, wenn mit "erheblichen Beeinträchtigungen öffentlicher Belange" zu rechnen ist (zit.n. Berliner Zeitung, 15.4.1998: 27). Bausenator Jürgen Klemann (CDU) plant derzeit, diese Passage aus der Ausführungsvorschrift zu streichen, um der Polizei damit Handhabe gegen "Penner, die zum Beispiel auf dem Breitscheidplatz lagern und sich die Hucke vollsaufen", zu geben. Ziel sei es, ein "ordentliches Stadtbild" zu bekommen. Als Anlaß für diesen Vorstoß kann der massive Protest des "Hotel Adlon" am Pariser Platz betrachtet werden, das seit Monaten ein Verbot der "fliegenden Händler" entlang der Straße "Unter den Linden" fordert. Mit der Streichung des Passus könnte dann auch gegen die Hütchenspieler nicht mehr in einer rechtlichen Grauzone - einer vermeintlichen "Sondernutzung öffentlichen Straßenlandes" -, sondern rechtlich gedeckt vorgegangen werden. Der Vorstoß soll in 14 Tagen mit den Bezirksbürgermeistern diskutiert werden und findet die Zustimmung von Innensenator Schönbohm.
Parallel wird eine erneute Änderung des "Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes" (ASOG) durch den Innensenat vorbereitet. Diese erneute Novellierung soll damit erstmals die Verhängung von Aufenthaltsverboten für z.B. DrogenkonsumentInnen ermöglichen, die bisher schon mit Platzverweisen und "Verbringung" bzw. "Verbringungsgewahrsam" konfrontiert waren; das Aufenthaltsverbot wird in Berlin - anders als in Dortmund, Bremen, Karlsruhe oder Hamburg - bisher nicht angewandt. Bereits 1992 wurde das ASOG in Hinblick auf die Vertreibung von Jugendlichen und Armutsbevölkerung aus dem Innenstadtbereich novelliert: Mit der Einrichtung sogenannter "gefährlicher Orte" an mittlerweile 30 Orten der Stadt, die häufig in der Nähe zu Fern-, S- und U-Bahnhöfen liegen, hat sich die Polizei ein weiteres Instrumentarium zur Raumkontrolle geschaffen, daß nun das Unterlaufen von Grundrechten ohne Tatverdacht ermöglicht: Personen- und Taschenkontrollen, Identitätsfeststellungen und ED-Behandlungen sind durch das novellierte "Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz" gedeckt. Im vergangenen Jahr ist auch die U-Bahnlinie 7 (mit Schwerpunkt Neukölln) selbst quasi zum "gefährlichen Ort" ernannt worden und wird von einer weiteren Sondereinheit der Polizei, dem "Sondereinsatzzug SEZ 7", uniformiert und in Zivil begleitet (vgl. Eick 1998). Im Bezirk Schöneberg, wo entlang der Potsdamer Straße täglich etwa 15 Platzverweise ausgesprochen (1997: 4.244) und 40 Personalienüberprüfungen durchgeführt werden (1997: 11.580), plant der Direktionsleiter derzeit, "die Grenzen des gefährlichen Ortes zu verändern" und auf die U-Bahn auszuweiten (zit.n. Orde 1998: 23).
Zu den bestbewachtesten Plätzen Berlins zählt das Areal rund um den Breitscheidplatz und den Bahnhof Zoo. Auch hier gingen den Aktivitäten von staatlicher Polizei und privaten Sicherheitsdiensten Beschwerden und Kampagnen der Privatwirtschaft, vor allem durch den Einzelhandelszusammenschluß "AG City" und die Deutsche Bahn AG, voraus. Noch heute finden die ca. 14-tägig ablaufenden Razzien der "Operativen Gruppe City-West" auf Zuruf von Geschäftsleuten statt und richten sich vor allem gegen MigrantInnen, aber auch gegen Bettler, Obdachlose und Jugendliche. Zum Ende möchte ich dazu noch einige Zahlen nennen: Das Areal um den Bahnhof gehört zum kleinsten Polizeiabschnitt Berlins mit den wenigsten BewohnerInnen (Abschnitt 27). Allein die Polizei - und hier vor allem die "Operative Gruppe City-West" - fahren täglich 2.000 Einsätze und sprechen täglich zwischen 20 und 70 Platzverweise mit 48-stündiger Gültigkeit aus; unterstützt wird die Schutzpolizei durch 12 private Sicherheitsdienste, von denen einer auch direkt auf dem Kurfürstendamm patrouilliert, von Sondereinheiten des Landeskriminalamtes (LKA) in Zivil und dem Bundesgrenzschutz, dessen Arbeitsschwerpunkt im öffentlichen Straßenland derzeit allerdings auf der Straße "Unter den Linden" liegt. "Bahn Schutz GmbH", BGS und die privaten Sicherheitsdienste treiben die "Unerwünschten" zunächst aus den U-, S- und Fernbahnhöfen. So hat der Bundesgrenzschutz im Rahmen der Hausrechtswahrnehmung für die Deutsche Bahn AG bereits mehrfach Hausverbote mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren ausgesprochen. Von dort werden Obdachlose und Junkies durch die Schutzpolizei und die privaten Sicherheitsdienste aus den Eingangsbereichen des Bahnhofs vertrieben, wie auch die sozialen Drogen- oder Obdachlosenhilfe-Projekte keine Aktivitäten in unmittelbarer Bahnhofsnähe entfalten dürfen. Diese Vertreibung reicht zunächst bis auf die andere Seite des Bahnhofsvorplatzes, wo wiederum private Sicherheitsdienste das Hausrecht wahrnehmen. Dort hat etwa der US-Konzern "MacDonald's" eine seiner Filialen; aber auch "Kentucky Fried Chicken" ist dort ansässig und besonders rabiat gegen MigrantInnen. Der Bezirksleiter von "MacDonald's" hält gar nichts von Obdachlosen am Bahnhof Zoo. Ohne klares Vorgehen "würde das Lokal nachts zur Obdachlosen-Wärmestube" (zit.n. Greiner/ Leschka/Neuhaus 1995: 25). Das sieht auch der Manager des Intercity- Restaurants so. Bei durchgehenden Öffnungszeiten des Restaurants ""haben wir genau das Publikum, das wir nicht wollen, das typische Bahnhof Zoo- Publikum". Also Stricher, Trinker, illegale Zigarettenverkäufer", so die Journalistin des Berliner "Tagesspiegel" (Binder 1994: 7). Belegt ist auch die Verfolgung von Junkies durch private Sicherheitsdienste bis an einen der Spritzenautomaten und die dann folgende Meldung eines "Straftäters" an die örtliche Polizei (persönliche Information durch Drogenberatungsstellen).
Ihre Fortsetzung findet das im Polizei-Jargon als Junkie- oder "Fixer- Jogging" bezeichnete Vertreiben entweder in deren Flucht in ein anderes Stadtquartier, wo ähnlich aufgebaute Einheiten tätig sind, oder mittlerweile zunehmend in die U-Bahnen. Hierin liegt eine gewisse Parallelität zu New York und dessen "Zero Tolerance"-Konzept, auf das ich hier nicht weiter eingehen will. Auch dort führte die Vertreibung von den Straßen zunächst noch unter Bürgermeister Dinkins zum Rückzug der Armutsbevölkerung in die U-Bahn (vgl. Behr 1997; Smith 1996).
Wie Untersuchungen der Drogenberatungsstellen "Strass" und "Fixpunkt" sowie der kirchlichen Organisation "Leben mit Obdachlosen" belegen, wird zunehmend der sogenannte "Verbringunsgewahrsam", also die Deportation an den Stadtrand, als Mittel eingesetzt. Etwa 40 Prozent der Befragten waren nach eigenen Angaben von dieser Maßnahme, zum Teil bereits mehrfach, betroffen. Landespolizei wie Bundesgrenzschutz führen diese Maßnahmen nach eigenen Angaben häufig durch.
In Berlin ist die Bahn zu einem der Hoffnungsträger für die Innenstadt aufgestiegen, und die von der Bahn AG auf dem Leipziger Bahnhofsvorplatz installierten Videokameras gelten dem Berliner Senat als besonders wünschenswert. Die Bahn AG soll Vorreiter werden, um der teilweise vorhandenen Widerständigkeit der Bezirke gegen die flächendeckende Videoüberwachung aller Plätze der Stadt privatwirtschaftlich die Spitze zu nehmen. So empfindet etwa der Berliner Innensenator, Jörg Schönbohm (CDU), das Leipziger Überwachungsmodell als vorbildlich für Berlin (QUELLE); aber auch das Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung des Landes Nordrhein-Westfalen positioniert sich ähnlich zur Bahn AG:
"Neben der Aufwertung des Unternehmens Bahn wird die städtebauliche Einbindung der Bahnhöfe zur Innenstadtbelebung und Attraktivitätssteigerung zunehmend wichtiger. Diese Ziele unterstützt auch das Land Nordrhein-Westfalen: Die NRW-Initiative "Standorte mit Zukunft" und die Bestrebungen um die "Vitale Stadt" stellen dabei im wesentlichen auf die Entwicklung hochleistungsfähiger Dienstleistungsstandorte ab", so ein Mitarbeiter des Landesinstituts (Rodemers 1998: 5).
Keines der für Berlin skizzierten Projekte ist indes unumstritten. So tragen einige Bezirksverwaltungen diese Maßnahmen derzeit noch nicht mit, was sich auch angesichts der Hauptstadtwerdung und der kürzlich beschlossenen Bezirksreform, die sowohl PDS- wie auch bündnisgrüne Bezirke schwächen bzw. auflösen wird, ändern könnte. Ausdruck für die Umkämpftheit dieser Räume sind aber auch die Bemühungen der Obdachlosen-Selbsthilfe- Organisationen, sich gegen die Ausgrenzungspolitik zu wehren. Der Widerstand gegen die Räumung der innerstädtischen "Wagenburgen" hat interessanter Weise dazu geführt, daß - unter der Maßgabe, sich nicht mehr in der Innenstadt sehen zu lassen - oben erwähntes Immobiliengespann für Obdachlose an der Peripherie einzelne Bauwagen anbietet (vgl. Obdachlosenplan Reinickendorf 1998).
Zusammengefaßt entsteht der Tendenz nach aus dem fordistischen "großen Bruder" der "Subventionsmetropole Berlin" die rassistische "Sicherheitsfamilie", die mit Public Private Partnership kleinräumig "Quartiersmanagement" für die "Kerngesellschaft" im "Unternehmen Berlin" betreibt.
Der städtische Raum wird kleinteilig mit ausdifferenziertem Ordnungsrecht wahlweise ghettoisiert bzw. für eine "attraktive Öffentlichkeit" inszeniert und von Störungen freigehalten. In Berlin, wo sich von den sechs großen Bahnhöfen - Bahnhof Zoo, Lehrter Bahnhof, Charlottenburg, Hauptbahnhof, Alexanderplatz (S-Bahn) und Bahnhof Lichtenberg - derzeit drei im Um- bzw. Aufbau befinden, sind an den drei bereits voll funktionsfähigen Bahnhöfen Knotenpunkte einer panoptischen Stadt entstanden, um die herum weitere Sicherheits- und Konformitätsstandards durchgesetzt werden sollen. Insoweit stellen sie nicht nur eine Parallele zu den Shopping Centers auf der "grünen Wiese" und den Shopping Malls, Atrien und neuen Plätzen, wie dem Potsdamer oder Leipziger Platz, dar, sondern weisen über deren Enklaven-Charakter hinaus. Sie sollen vielmehr der Nukleus für die sichere Stadt im 21. Jahrhundert werden.
Damit stellen Bahnhöfe in Hinblick auf kommunale, innerstädtische Sicherheits- und Ordnungsinteressen privatwirtschaftlich geführte und staatlich wie privatwirtschaftlich bediente Filialen zur Etablierung neuer Sicherheits- und Ordnungsmodelle dar. Der "Geschäftsbereich Personenbahnhöfe" und der Bundesgrenzschutz können insoweit als auf Wachstumskurs befindliche Filialleiter des "Unternehmens Berlin" gelten.
7 Literaturauswahl
- Behr, Rafael 1997: Zweifelhafte Vorbilder. Die Wirkung der "New York"- Metapher auf die deutsche Polizei(politik), in: Gunter Dreher/Thomas Feltes (Hrsg.): Das Modell New York: Kriminalprävention durch "Zero Tolerance"? Beiträge zur kriminalpolitischen Diskussion, Felix Verlag, Holzkirchen/Obb., S.148-160
- Binder, Elisabeth 1994: "Was wollen Sie machen, bei dem Publikum...". Bahnhof Zoo bietet Berlin-Besuchern erschreckendes Bild, in: Der Tagesspiegel vom 20. Januar 1994, Berlin, S.7
- Brunn, Burkhard/Dietrich Praeckel 1992: Der Hauptbahnhof wird Stadttor. Zum Ende des Automobilzeitalters, Anabas Verlag, Gießen
- BSG. Bahn Schutz & Service GmbH 1997 (Hrsg.in): Starker Schutz & kompletter Service. Die Sicherheitsprofis für zufriedene Kunden (Informationsmappe), Selbstverlag, Frankfurt/M.
- Bueß, Peter 1997: Private Sicherheitsdienste. Zur Tätigkeit freier Unternehmer auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/u.a.
- Bund Deutscher Architekten/Deutsche Bahn AG/Förderverein Deutsches Architekturzentrum (Hrsg.Innen) 1997: Renaissance der Bahnhöfe. Die Stadt im 21. Jahrhundert, Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden
- Bundesministerium des Innern (Hrsg.) 1997: Konzept der Neuorganisation des Bundesgrenzschutz (BGS), 11. September 1997, Bonn
- Deutsche Bahn AG (Hrsg.in), o.J. [1996]: Die Marke Bahnhof. Geschäftsbereich Personenbahnhöfe, Selbstverlag, Frankfurt/M.
- Deutsche Bahn AG (Hrsg.in) 1996a: Geschäftsbericht 1995, Selbstverlag, Frankfurt/M.
- Deutsche Bahn AG (Hrsg.in) 1997: Renaissance der Bahnhöfe. Die Stadt im 21. Jahrhundert, (Ausstellungsbeiheft vom März 1997) Selbstverlag, Berlin
- Deutsche Bahn AG (Hrsg.in) 1997a: Geschäftsbericht 1996, Selbstverlag, Frankfurt/M.
- Eick, Volker 1997: "Schluß mit den Problembürgern!" Eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG schafft öffentliche Räume, in: MieterEcho. Zeitung der Berliner MieterGemeinschaft (Nr. 265), Nov./Dez. 1997, S.8-9
- Eick, Volker 1998: Neue Sicherheitsstrukturen im "neuen" Berlin. "Warehousing" öffentlichen Raums und staatlicher Gewalt, in: ProKla. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft, Heft 110: "S(t)andOrt Berlin" (März 1998), Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster, S.95-118
- Ermittlungsgruppe 1998: Bundesgrenzschutzinspektion Berlin, Bahnhof Zoo (Ermittlungsgruppe). Mitteilung über die Ermittlung gegen einen Tatverdächtigen, Berlin
- Greiner, Benjamin/Leschka, Simon/Neuhaus, Stephan 1995: Fünf Tupfer Senf, fünf Tupfer Ketchup. Ökobirnen im Schnellrestaurant, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Jugend schreibt), Frankfurt/M., S.25
- IMK-Beschluß 1998: Beschlußniederschrift über die Sitzung der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder am 2. Februar 1998, Bonn
- Kant, Martina/Pütter, Norbert 1998: Sicherheit und Ordnung in den Städten. Zwischen "Sicherheitsnetz" und "Ordnungspartnerschaften", in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 59 (1/98), Cilip Verlag, Berlin, S.70-79
- Kaufmann, Franz-Xaver 1973: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Phänomen. Untersuchungen zu einer Wertidee hochdifferenzierter Gesellschaften (2. umgearbeitete Auflage), Enke Verlag, Stuttgart
- Kessow, Peter-Michael 1997: Bahnpolizeiliche Aufgaben des Bundesgrenzschutzes. Organisation, Zuständigkeiten, Einsatz, Zusammenarbeit mit Behörden und anderen Institutionen, Richard Boorberg Verlag, Stuttgart/u.a.
- Leisting, Wolfgang 1997: Polizeirecht und offene Drogenszene, in: Josef Estermann (Hrsg.): Auswirkungen der Drogenrepression. Illegale Drogen: Konsum, Handel, Markt und Prohibition (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, Band 15), Verlag für Wissenschaft und Bildung, Berlin
- Martin, Joachim 1995: Entkriminalisierungsvorschläge. Beispiel: Beförderungserschleichung (§ 265a StGB), in: Rolf Gössner (Hrsg.): Mythos Sicherheit. Der hilflose Schrei nach dem starken Staat, Nomos Verlag, Baden-Baden
- Maurer, Albrecht 1998: Schleierfahndung im Hinterland. Das ganze Land als "zweite Grenzlinie", in: Bürgerrechte & Polizei/CILIP 59 (1/98), Cilip Verlag, Berlin, S.51-56
- Orde, Sabine am 1998: Verdrängung in die U-Bahnhöfe. Polizei zieht positive Bilanz im Kampf gegen Straßenkriminalität, in: die tageszeitung vom 23. April 1998, S.23, Berlin
- PDS-Bundestagsgruppe (Hrsg.in) 1997: DB AG. Deutsche Bahn Abwicklungs- Gesellschaft. Ein alternativer Bericht über die Geschäfte der Deutschen Bahn AG (2. erweiterte Auflage), Selbstverlag, Bonn
- Rodemers, Jakob 1998: Sicherheit in Bussen und Bahnen, an Haltestellen und an Bahnhöfen (Vortrag, gehalten an der Universität Kaiserslautern am 5. Februar 1998), unv. Manuskript (S. 1-21), Dortmund/Kaiserslautern
- Smith, Neil 1996: The New Urban Frontier. Gentrification and the Revanchist City, Routledge, London/New York
- Schivelbusch, Wolfgang 1989: Geschichte der Eisenbahnreise. Zur Industrialisierung von Raum und Zeit im 19. Jahrhundert, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M.
- S-Bahn Berlin (Hrsg.in) 1998: Mobilität, Innovation, Flexibilität, Fortschritt (Marketingbroschüre der S-Bahn Berlin GmbH), Selbstverlag, Berlin
- Senatsverwaltung für Inneres (Hrsg.in) o.J. [1998]: Hintergrundinformationen zur "Aktion Sicherheitsnetz", Berlin Unterreiner, Frank Peter 1998: Ein Generationen-Projekt: Stuttgart 21. Die Innenstadt wächst um 100 Hektar, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 20. Februar 1998, S.45
- Wiedenroth, Pascale 1995: Safety First! Sicherheit im Zug, in: ZUG. Für Menschen unterwegs (Ausgabe Januar 1995), S.24-27, Frankfurt/M.
- Wolf, Winfried 1992: Eisenbahn und Autowahn. Personen- und Gütertransport auf Schiene, Straße, in der Luft und zu Wasser. Geschichte, Bilanz, Perspektiven (erweiterte Neuausgabe), Rasch und Röhring Verlag, Hamburg/ Zürich
Siehe Dokument: http://www.is-kassel.de/%7Esafercity/2000/der_deutsche_bahnhof.html [Link nicht mehr verfügbar]
Bettina Sokol
"[...] In einem ganz anderen Zusammenhang stehen wiederum Videoüberwachungssysteme, die auf öffentlichen Plätzen installiert sind und beispielsweise mit um 360° drehbaren Kameras und ferngesteuerter Zoom-Technik gestochen scharfe Portraits von Passantinnen und Passanten liefern und aufzeichnen können. Solche Beobachtungssysteme existieren bereits, wenn auch nicht von der Polizei installiert, der dies rechtlich verwehrt ist. Am Düsseldorfer Hauptbahnhof beispielsweise entsteht seit Mitte November 1998 - vorsichtig ausgedrückt - eine gewisse Gemengelage. Die Deutsche Bahn AG - ein Privatunternehmen und damit außerhalb der Zuständigkeitsbereiche der Landesdatenschutzbeauftragten - hat ein derartiges Überwachungssystem im Bahnhof und auf dem Bahnhofsvorplatz eingerichtet. Nach Presseberichten beobachten 72 Kameras rund um die Uhr das Geschehen, das auf 16 Monitoren in der "3-S-Zentrale" landet.
Der Bahnhofsvorplatz ist bahneigenes Gelände, die Kameras können ihr Sichtfeld allerdings auch auf den angrenzenden öffentlichen Straßenraum erstrecken. Die Bahn weist zwar generell durch Aufkleber an Türen und auf den Bahnsteigen auf die Videoüberwachung hin, stellt in der Überwachungszentrale jedoch ebenfalls einen Arbeitsplatz den Sicherheitsbehörden zur Verfügung. Nach einer ersten Auskunft des Polizeipräsidiums wird dieser Arbeitsplatz vornehmlich vom Bundesgrenzschutz genutzt, aber gelegentlich auch von der Polizei [...]"
Bettina Sokol, Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen
Zum BGSDer Bundesgrenzschutz (BGS) hat sich zum Leidwesen bürgerlicher Freiheiten von der militärischen Truppe zur Bundespolizei entwickelt. Ihm wurden von der Schleierfahndung über Ermittlungen, Observationen und Lauschangriffen eine Reihe bedenklicher Eingriffsbefugnisse zugestanden. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine Aufweichung der Länderkompetenzen.