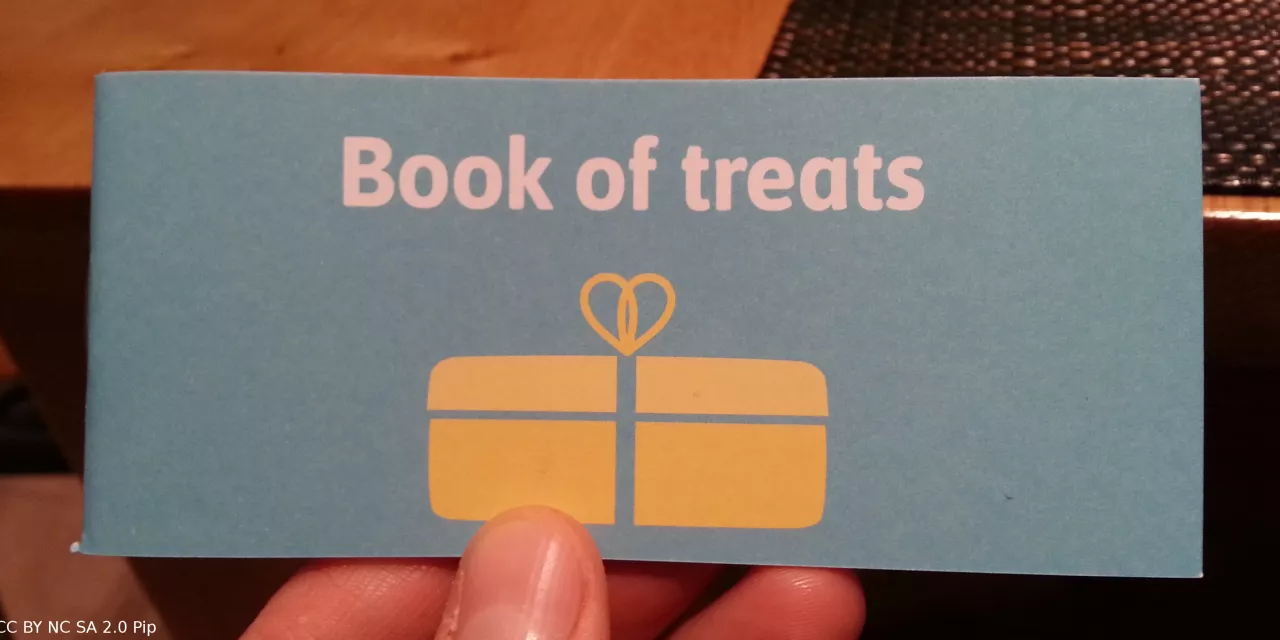Der BigBrotherAward 2011 in der Kategorie „Technik“ geht an die Modemarke Peuterey, vertreten durch den deutschen Vertreiber, die Düsseldorfer Modeagentur „Torsten Müller“.
Er erhält diese Negativ-Auszeichnung, weil seine Agentur die Kleidung der italienischen Modemarke Peuterey mit einem verdeckt integrierten RFID-Funkchip in Verkehr bringt, der berührungslos auslesbar ist, ohne dass die Kunden das bemerken können. Der Aufnäher, der diesen „Schnüffelchip“ enthält, wird – ohne Hinweis auf den verborgenen Chip – mit dem Satz „Don’t remove this label“ bedruckt. Damit greifen die Agentur und der Hersteller massiv in die informationelle Selbstbestimmung der Kundinnen und Kunden ein.
Angenommen, ich schaue mir hier im Raum eine Person aus. Sie zum Beispiel. Ich gebe Ihnen den Namen 27BStrich6. Und ich installiere in Ihrer Kleidung eine kleine Abhörwanze, die mir in unregelmäßigen Abständen Ihren Aufenthaltsort zusendet. Dann weiß ich, wo Sie sich, also die Person, der ich die Nummer 27BStrich6 gegeben habe, tagsüber und nächstens aufhalten.
Ich glaube, wenn Sie das wüssten, hätten Sie ein ganz komisches Gefühl in der Magengrube. Und da wäre Ihnen auch egal, ob ich nun weiß, dass Sie Hans oder Gabi heißen. Und es ist Ihnen auch egal, ob ich persönlich das weiß, oder nur meine riesige Datenbank. Es ist Ihnen auch egal, ob ich beteuere, Ihnen mein Ehrenwort gebe, diese Informationen gar nicht auszuwerten. Ich KÖNNTE diese Informationen auswerten. DAS zählt: Sie wollen nicht, dass ich Sie mit einer Wanze ausstaffiere und ich Ihnen einen Namen gebe, der nicht Ihr Name ist, sondern meine Bezeichnung für Sie. Es ist eine Bezeichnung, die ICH Ihnen gegeben habe, um Macht über Sie auszuüben, und gleichzeitig will ich Sie glauben machen, dass sie nichts von mir zu befürchten haben.
Warum erzähle ich Ihnen das? Weil eine junge Frau, ich nenne sie mal Jana Sorglos, in Bielefeld einkaufen gegangen ist. Sie kauft in einem Laden namens „Brooks“ in Bielefeld eine Jacke der Marke Peuterey. Die Jacke ist nicht besonders schön, aber dafür auch nicht billig, was es wieder ausgleicht. Sie bezahlt die Jacke. An der Kasse wird eine Diebstahlsicherung entfernt. Jana Sorglos geht nach Hause. Sie ist eine sehr sorgfältige Frau. Später auf dem Sofa betrachtet sie ihre Einkaufsbeute, genießt die Glückshormone und entfernt anhängende Etiketten – weil das immer komisch aussieht, wenn so ein Etikett beim Tragen noch aus dem Kragen heraushängt. Außerdem hat sie mal mitbekommen, dass in solchen Etiketten Schnüffelchips drinstecken können, die irgendwie Daten raussenden und mit denen man ihr auf Schritt und Tritt folgen könne. So genau kann sie sich nicht dran erinnern. Aber da gab’s schon mal einen BigBrotherAward, im Jahr 2003 …
Was Jana nicht ahnt: Flach im Rückenteil der Jacke ist ein viereckiges Stoffetikett fest eingenäht. Es sagt uns nochmal, wie toll diese großartige Jacke ist, dass die Jacke eigentlich für Seefahrer ist und dass sie eine Seriennummer hat. Zum Beispiel: 27BStrich6. Und es steht noch was drauf: „Don’t remove this label“ („Auf keinen Fall entfernen!“). Was nicht drauf steht – Sie ahnen es schon – ist, dass dieses Etikett einen Schnüffelchip enthält.
Einen Schnüffelchip. Deutsch ausgesprochen RFID oder amerikanisch RFID, wir können auch Funkchip sagen. Er ist z.B. in Universitätsausweise integriert (und wird dort Mifare genannt), in vielen Bibliotheken verbreitet, ins Hotelzimmerschlüsselkärtchen eingebaut, wird uns mit der Bahncard100 untergeschoben und heißt im Smartphone NFC (Near Field Communication). Das Problem: Diese Schnüffelchips bestehen grob gesagt aus drei Teilen: Dem eigentlichen Chip, dieser enthält eine fest ab Fabrik eingebaute Seriennummer, und an das Ganze ist dann noch eine kleine Antenne angelötet. Und Dank internationaler Standardisierung muss jedes Lesegerät, an dem ich vorbei komme, die Nummer des Chips auslesen, auswerten, wegwerfen – oder abspeichern. Wo ich gehe und stehe – überall da, wo solche Lesegeräte installiert sind (und es werden immer mehr) – hinterlasse ich meine Nummer: 27BStrich6 … 27BStrich6 … 27BStrich6 … Und diese Nummer gehört nur mir, nur in dieser einen Jacke. Die Jacke daneben hatte schon eine andere Nummer bekommen. Das nennt man „Item-Level-Tagging“, also die Praxis, jedem Produkt eine ganz individuelle Nummer zu geben. Dadurch werde genau ich durch meine Jacke eindeutig identifizierbar.
Eine Firma, die so etwas versteckt in Verkehr bringt und nicht einmal durch Aufdruck darauf hinweist, sondern stattdessen auch noch „Don’t remove this label“ auf das Etikett schreibt: Dieser Firma gebührt auf jeden Fall ein BigBrotherAward.
Was da momentan passiert, ist schlimm. Jana Sorglos hat Recht. Es gab bereits einen BigBrotherAward zum Thema RFID. Die Metro AG hatte den 2003 bekommen, und in der Laudatio damals beschrieben wir ein ausgedachtes Szenario:
„Die Supermarkt-Fachkraft Gerd J. ist begeistert von der neuen Technik. Das lästige An-der-Kasse-Sitzen fällt weg, die Regale sind leichter befüllbar, die Lager effektiver genutzt. Als er abends nach Hause kommt, liegt dort ein Brief seiner Geschäftsleitung mit einer Abmahnung. Er sei in den vergangenen Wochen durchschnittlich 9 Mal auf der Toilette gewesen und habe dort pro Tag ca. 72 Minuten zugebracht. Das liege 27 Minuten über dem Soll und diese Zeit werde ihm zukünftig von seinem Arbeitszeitkonto abgezogen. Entsetzt sucht er seinen Supermarkt-Kittel ab und findet einen RFID im Kragensaum.“
Das hatten wir gar nicht erfunden. Chips im Kragen gab’s damals schon. Aber mittlerweile ist die Technik fortgeschritten. Nehmen Sie mal ein 1-Cent-Stück in die Hand. Schauen Sie auf die Vorderseite – also da, wo die Zahl drauf steht – wenn Sie genau gucken, sehen Sie auf der rechten Seite der Münze die Abbildung einer kleinen Weltkugel. Das ist etwa die Größe eines Chips, den die Firma Deister Elektronic in Wäscheetiketten klebt. Der besondere Clou: Die notwendige Antenne, die eine gewisse Größe haben muss, ist bereits Teil des Wäschetikett-Gewebes. Dieser Chip ist so klein, den finden Sie quasi nur noch per Zufall, wenn man Ihnen ein solches Kleidungsstück unterjubelt. 2003 waren die kleinsten experimentellen Chips mindestens Reiskorn-groß oder z.B. bei der Metro-AG so groß wie ein Fingernagel.
RFID-Chips sind auch nicht mehr so schwach wie damals, 2003, als die Metro AG mit Chips experimentierte, die auf der Frequenz 13,56 MHz funkten. Seitdem sind Reichweite und Zuverlässigkeit der Schnüffelchips immens gewachsen. Machten wir uns früher lustig über die Technik, die weder hinten noch vorne funktionierte, so bleibt uns das Lachen heute im Halse stecken. Denn heute kann ich mit einem Handlesegerät an einem Kleiderständer im Laden entlangstreifen und das Gerät erfasst im Vorübergehen sämtliche Kleidungsstücke.
Peuterey ist ein kleines Label – andere arbeiten damit im großen Stil. Die Firma Gerry Weber führt dieses System gerade in ihren Läden ein. Alle Kleidungsstücke werden in den Waschinformationsetiketten mit RFID-Chips versehen und kommen so ausgestattet in die Läden. Das diene dem Diebstahlschutz, sagte uns die Firma. Und in jedem Laden kann abends schnell Inventur gemacht, der Soll-Bestand mit dem Ist-Bestand abgeglichen werden. Anders als die Firma Peuterey hat Gerry Weber sich allerdings Gedanken um den Datenschutz gemacht. Sie haben sich mit Experten des FoeBuD getroffen und ihr Konzept offen gelegt. Einige Vorschläge des FoeBuD haben sie auch gleich umgesetzt. Aber an der wichtigsten Stelle sind sich Gerry Weber und wir vom FoeBuD nicht näher gekommen: Schnüffelchips fest eingenäht in Kleidung sind ein so genanntes No Go. Die Gefahr, die wir sehen, ist die zunehmende Kontaminierung der Welt mit Seriennummern. Die 27BStrich6 wird da und dort auftauchen. Vielleicht erst einmal nur unbeabsichtigt. Aber je mehr Daten sich anhäufen, desto mehr werden die Begehrlichkeiten geweckt, aus diesen Daten Informationen zu schürfen und zu verwerten. Wir bleiben bei unserer Forderung: RFID-Chips von der Herstellung bis zum Lager des Ladens sind Ok. Aber im Verkaufsraum selbst darf kein Chip mehr drin sein.
Die Metro gaukelte uns 2003 zum Beispiel vor, die Chips seien elektronisch abschaltbar. Das war in der uns damals präsentierten Umsetzung reine Augenwischerei, reicht aber auch nicht aus. Welcher Kunde kann schon nachprüfen, ob eine Abschaltung wirklich funktioniert? Woher soll ich wissen, ob man den kleinen Schnüffler nicht genauso elektronisch und heimlich wieder einschalten kann? Bislang hat auch kein Hersteller ein Konzept vorgelegt, bei dem die gechippten Etiketten außen angebracht sind und nicht nur auf Wunsch der Kundin, sondern IMMER entfernt werden. Modebranche aufgemerkt! – Lesen Sie es von meinen Lippen ab: Wenn schon Funkchips an der Kleidung (oder anderen Waren) angebracht sind, dann MÜSSEN diese an der Kasse oder vor dem Versand entfernt werden.
Hier hat auch Gerry Weber sich noch nicht bewegt. Deshalb werden wir wohl Druck machen müssen, vor Gerry-Weber-Läden Mahnwachen aufstellen und die Öffentlichkeit auf diese Art auf diese Herausforderung aufmerksam machen.
Ich halte Gerry Weber für eine nach guter ostwestfälischer Tradition mittelständisch seriös geführte und kritikfähige Firma. Ich glaube Gerry Weber, dass sie nicht vorhaben, „Böses“ mit den ganzen gesammelten Nummern zu machen. Aber es ist nur 7 Jahre her, dass mir der damalige EDV-Leiter der Firma versicherte, dass sie unser internationales Positionspapier kannten und sie deswegen nur recyclebare Anhänger mit Schnüffelchip an die Kleidung anbringen würden. Nun ist da ein neuer EDV-Leiter, jetzt sind es doch nicht mehr die Anhänger, sondern eingenähte Waschetiketten mit RFID. Was wird der nächste EDV-Leiter beschließen?
Und wenn Gerry Weber noch so seriös ist: Wenn das Konzept, das die Firma eingeführt hat, technisch und finanziell funktioniert, dann werden die ganzen unseriösen, gierigen und verantwortungslos handelnden Unternehmen auch nach diesen Chips geifern. Diese werden die Chips einsetzen, ihre Kunden nicht informieren und die Chips an der Kasse nicht herausschneiden. So breitet sich dann immer mehr eine zur Ausforschung und Überwachung nutzbare Struktur aus. Wenn Sie, die Inhaberin der Nummer 27BStrich6 durch eine Innenstadt gehen, wird Ihr Weg nachverfolgbar sein. Die Leute, die die Macht, also den Datenbestand besitzen, den die Lesegeräte eingesammelt haben, diese Leute werden Ihnen wie perfekte Stalker hinterherschnüffeln. Irgendjemand wird diese Daten kaufen und irgendwas damit machen. Irgendwas, was ich mir heute noch gar nicht ausdenken kann, was mir aber bereits jetzt ein heftiges mulmiges Gefühl in der Magengrube verschafft.
Deshalb brauchen wir Gesetze. Wir brauchen Gesetze, die die Peutereys, die Kicks, die Lidls, die Ernstings Families, und, ja, auch die Gerry Webers dazu zwingt, ihre Anwendungen so zu gestalten, dass von ihnen keine Gefahr für das Menschsein ausgeht.
Sie fragen sich sicher, warum wir Gerry Weber nicht den BigBrotherAward verleihen. Nun, sie hatten das Glück, dass jemand die Modefirma Peuterey nominiert hat. Und wir finden es weitaus schlimmer, dass so eine Firma quasi Spionagewanzen in Umlauf bringt. Und der deutsche Hauptvertrieb der italienischen Modefirma sitzt in Düsseldorf, eben jene Modeagentur Torsten Müller, die für die Verbreitung in Deutschland verantwortlich ist und sich dafür nun über den BigBrotherAward freuen darf.
Die Arbeit für eine überwachungsfreie Welt geht weiter. Für heute aber bleibt mir erst mal nur noch zu sagen:
Herzlichen Glückwunsch zum BigBrotherAward 2011 der Kategorie Technik, Herr Müller.