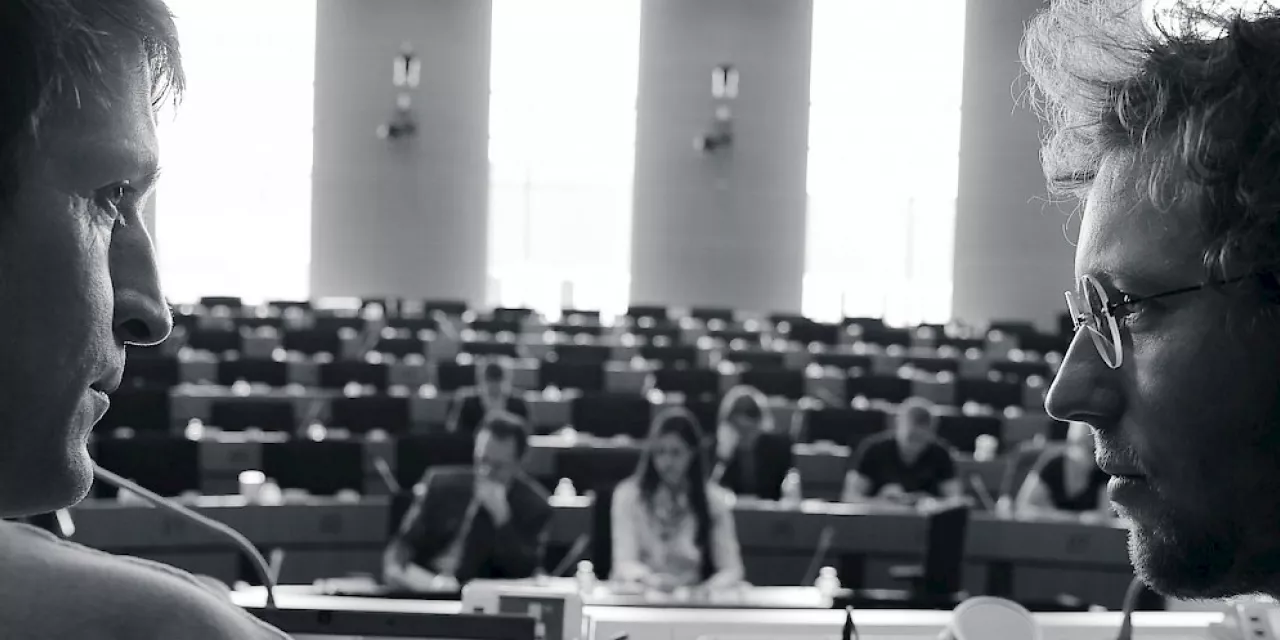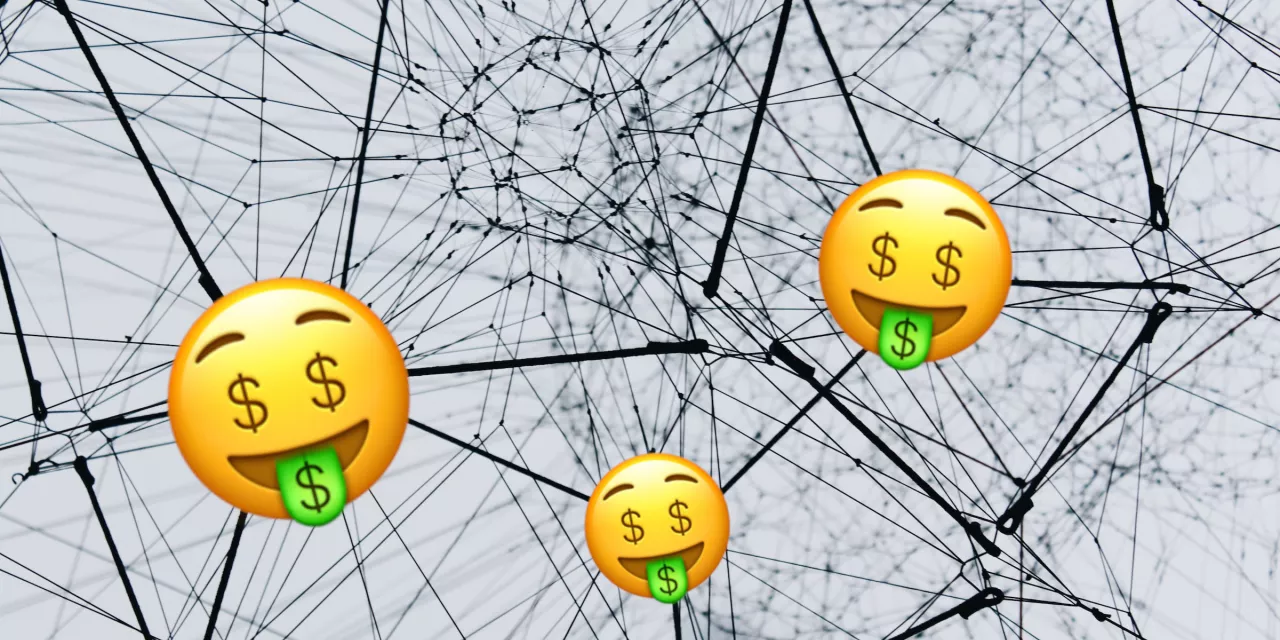change.org antwortet auf BigBrotherAward
Gregor Hackmack von change.org behauptet, man habe ihm die Rede verweigert bei der Verleihung der BigBrotherAwards. Tatsächlich haben wir ihn ja auf die Bühne gebeten und er hätte zum Reden einfach nur drei Schritte in die Bühnenmitte zum Mikrofon des Moderators gehen müssen - so wie es mit ihm vorher abgesprochen war. Nachdem er das verstanden hatte, gab er dann ein 5 Minuten langes Statement ab. Hier das Transkript seines Beitrags.
Leider gibt das Statement wenig substantielle Antworten auf zentrale Vorwürfe der Laudatio. Aber urteilen Sie selbst:
„Ich selber bin total überrascht, dass wir diesen Award bekommen. Das hätte ich mir nicht träumen lassen und die Überraschung ist Euch wirklich gut gelungen.“
„Ich bin seit Jahren selber engagiert, für Transparenz für Datenschutz, viele aus diesem Raum kenne ich. Wir haben gemeinsam viele Kampagnen gemacht. Das Transparenzgesetz in Hamburg auf den Weg gebracht. Wir haben immer nach der Devise gehandelt: Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.“
„Worum geht es hier eigentlich auf change.org. Es geht um Petitionen. Petitionen sind an sich, per se [ein] öffentlicher Akt. Ich möchte mich für eine Sache einsetzen in der Demokratie, ich möchte mich öffentlich dazu bekennen. Ich selber komme aus dem Wendland. Damals im Wendland haben wir unsere Unterschriften gegen die Atomkraft in der Lokalzeitung veröffentlicht, um öffentlichen Druck aufzubauen. Und auf Change.org ist es eben möglich, Einzel-Anliegen per Unterschrift zu unterstützen. Das Einzige was man bei uns braucht, ist tatsächlich eine gültige E-Mail Adresse. Man kann sich einen anderen Namen ausdenken, man kann unter Pseudonym unterschrieben, selbstverständlich. Man muss nichts weiter angeben.“
„Jeder gemeinnützige Verein, inklusive Digitalcourage sammelt mehr Daten über die Unterstützerinnen und Unterstützer als change.org. Denn Ihr sammelt die Bankverbindung, Ihr sammelt die Postadresse um die Spendenbescheinigungen zuzusenden und dass Onlinepetitionen natürlich auch von gemeinnützigen Organisationen genutzt werden können, um den eigenen Unterstützerkreis und Newsletter aufzubauen, dass ist was ganz normales. Jede gemeinnützige Organisation hat einen Newsletter, übrigens auch Digitalcourage. (Worüber ich die Einladung übrigens auch parallel bekommen hab. Vielen Dank. Ich bin großer Unterstützer und großer Fan von Euch.) Und in sofern geht es natürlich immer darum diese Newsletterverteiler zu erweitern und bei uns können Bürgerinnen und Bürger kostenlos diese Petitionen starten. Gemeinnützige Organisationen haben zusätzlich die Möglichkeit ihren Newsletter zu bewerben und dann können Bürgerinnen und Bürger beispielsweise den Newsletter einer Organisation die sich für Datenschutz einsetzt dann abonnieren. Und so ihren Verteiler eben vergrößern. Und das ist ein Angebot was wir machen und wir finden das auch richtig, dass wir das machen.“
„Wir sind eine offene Plattform. Es gibt auch andere Modelle. Campact beispielsweise, Kooperationspartner von Digitalcourage. Da kann man das auch so machen, dass man eine Kampagne startet für Netzneutralität – so geschehen 2014 und dann Unterschriften sammelt und dann im Anschluss eben da den Spendenaufruf oder den Förderaufruf für die eigene Organisation drüberschickt, über genau diesen Verteiler. Da habt Ihr eine Menge Förderer und Spender gewonnen. Finde ich auch richtig, weil es braucht Organisationen, die sozusagen dann auch in der Zivilgesellschaft aufbauen, recherchieren und so weiter und deswegen finde ich unser Modell super. Das ist ein Parallelmodell und letztendlich nützt das allen und das stärkt die Zivilgesellschaft.“
[Zwischenruf, unverständlich, Moderator stoppt Zwischenruf]
„Es geht letztendlich im Aktivismus natürlich nicht ums Geld. Das ist auch wichtig. Es geht um soziale Wirkung und ich bin stolz darauf, dass bei Change.org fast jede Stunde eine Kampagne erfolgreich ist. Vor 2 Monaten haben bspw. 370.000 Menschen in Indien dafür gesorgt, dass die Netzneutralität erhalten bleibt. An diesem Montag hat Marianne Grimmstein, Musiklehrerin aus Lüdenscheid (nicht weit von hier) eine Bürgerklage beim Bundesverfassungsgericht gegen CETA eingereicht mit über 70.000 Vollmachten, die sie als Einzelperson mit Hilfe ihrer Petition auf Change.org gesammelt hat und insofern begeistert mich das Modell von Change.org und ich erkläre es gerne im Anschluss.“
„Wir verkaufen keine Adressen, sondern wir geben den NGOs die Möglichkeit ihre NGOs bei uns zu bewerben und jeder Nutzer muss natülich jedesmal wieder zustimmen, wenn er bspw. an einer Umweltschutzorganisation oder Datenschutzorganisation über die Zeichnung seiner Petition hinaus interessiert ist. Das machen wir transparent, darum stehe ich heute hier. Und ich hätte es auch vor 5 Minuten schon gemacht, wenn Ihr mir das Mikro gegeben hättet.“
„Ich lade Euch ein, lasst uns diskutieren darüber, vielleicht habt Ihr auch Lust, die eine oder andere Kampagne zu starten. Wir sind für Euch da. [Lacht] und ich finde den Preis in dem Fall nicht gerechtfertigt. Wir klären darüber auf, auch was ein Sozialunternehmen ist. Ein Sozialunternehmen ist eine Organisation, die zwar unternehmerisch tätig ist, aber nicht mit Gewinnabsicht. Ganz im Gegenteil: Unsere sozialen Investoren müssen immer wieder investieren, quasi in das Unternehmen hinein spenden. Also insofern, ich finde das eine super Sache. Ich lade Euch ein und danke Euch für die Aufmerksamkeit und dass ich am Ende doch noch was sagen durfte.
Vielen Dank.“
[Bemerkung Moderator "Hat er irgendwie nicht richtig verstanden. Er wäre auf jeden Fall zu Wort gekommen."]
23. April 2016
Foto (v.l.n.r.): Andreas Liebold, padeluun,Jeanette Gusko, Gregor Hackmack.
Quellen (nur eintragen sofern nicht via [fn] im Text vorhanden, s.u.)
Die BigBrotherAwards-Laudatio zu change.org samt allen Quellen und Links finden Sie hier
Video der BigBrotherAwards-Verleihung 2016
Transkript, Rede von Gregor Hackmack, change.org, 22.4.2016
Video Aufzeichnung BigBrotherAwards 2016