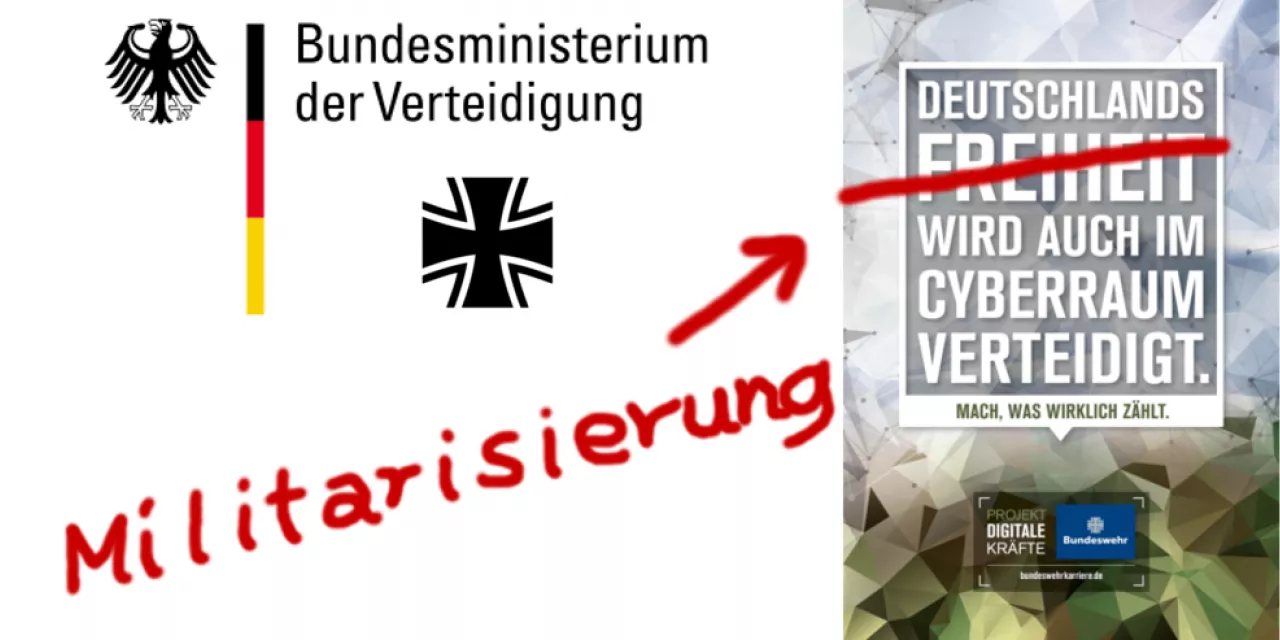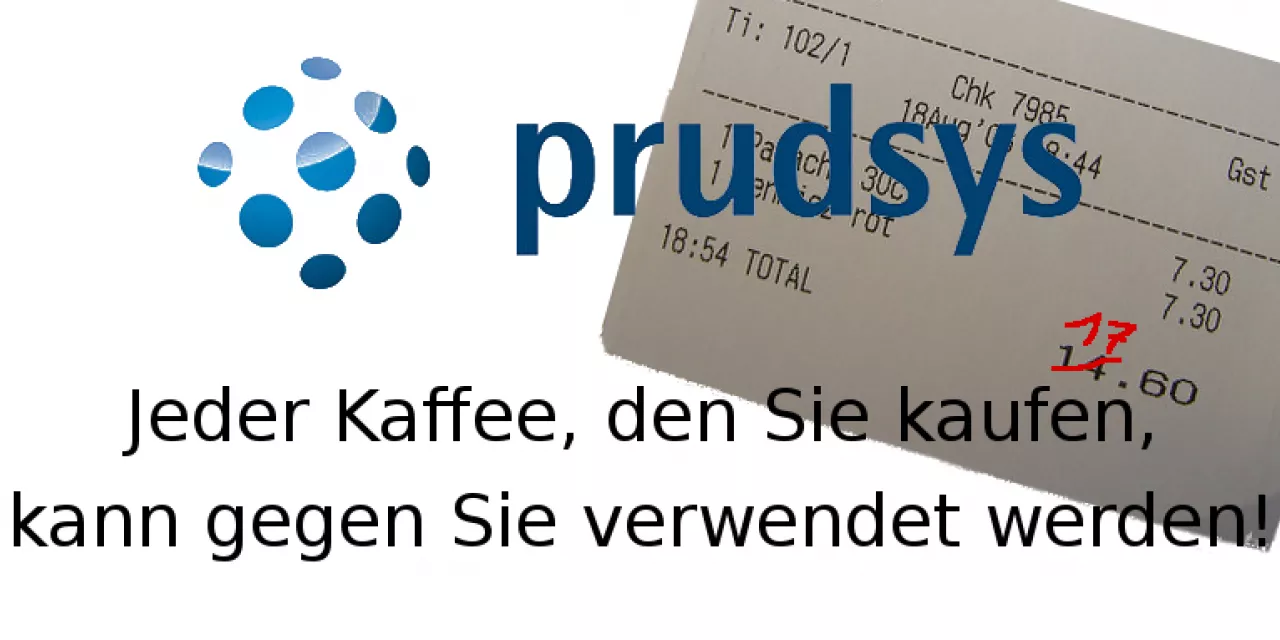Der BigBrotherAward 2017 in der Kategorie Wirtschaft geht an den deutschen IT-Branchenverband Bitkom, vertreten durch seinen Präsidenten Thorsten Dirks. Der IT-Branchenverband erhält diesen BigBrotherAward für sein unkritisches Promoten von Big Data, seine penetrante Lobbyarbeit gegen Datenschutz und weil er de facto eine Tarnorganisation großer US-Konzerne ist, die bei Bitkom das Sagen haben.
Bitkom – wer ist das überhaupt, was machen die? Hier im Stakkato: Bitkom ist der IT-Branchenverband in Deutschland, wurde 1999 gegründet, hat rund 1.600 Mitglieder, veranstaltet den jährlichen „IT-Gipfel“ mit der Bundesregierung (der ab 2017 als „Digital-Gipfel“ firmiert), macht Studien, wird von der Bundesregierung immer gefragt, wenn „irgendwas mit Computern“ zur Debatte steht und hat beste Beziehungen zur Politik.
Und was meint Bitkom zum Datenschutz?
Datenschutz – findet Bitkom – „passt nicht in die heutige Zeit“, ist „veraltet“, „analog“1, „letztes Jahrhundert“2, überreguliert und nicht mehr zeitgemäß3. Hier bestimmt offenbar das Sein das Bewusstsein. Einbrecher finden auch, dass das Prinzip des Eigentums veraltet sei.
Aber lassen wir die Bitkom-Vertreter.innen doch selber zu Wort kommen:
Zitat Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder:
„Selbstverständlich kann es nicht darum gehen, den Datenschutz abzuschaffen. Im Gegenteil: Je stärker Daten eingesetzt werden, umso stärker müssen sie gegen Missbrauch geschützt werden – rechtlich, technisch, organisatorisch. Genau diese Unterscheidung aber wird kaum gemacht: Sinnvoller Gebrauch gegen unerwünschten Missbrauch.“
Doch halt – wer entscheidet eigentlich, was „Missbrauch“ und was „sinnvoller Gebrauch“ ist? Im Klartext heißt das vermutlich: „Um Ihre Daten zu schützen, müssen wir sie erstmal haben! Also her mit Ihren Daten, denn wir machen was Sinnvolles damit, nämlich Geld! Wenn jemand anderes an unseren Datenschatz heranwill, dann ist das Missbrauch.“
Nächstes Zitat: Dieter Kempf, Ex-Bitkom-Präsident, beim Safer Internet Day 2015:
„Ob das Konzept der Datensparsamkeit heute noch in dieser Absolutheit sinnvoll und geeignet ist, moderne Datenverarbeitung zu regulieren, muss man auch einmal fragen dürfen.“
Bitkom propagiert „Datenreichtum“ statt Datensparsamkeit So im Bitkom-Positionspapier zur „Digitalen Souveränität“. Zitat:
„Zwei Grundprinzipien des Datenschutzes – Datensparsamkeit und Zweckbindung – sind zu überprüfen und durch die Prinzipien der Datenvielfalt und des Datenreichtums zu ergänzen bzw. zu ersetzen.“
Auch Susanne Dehmel, Mitglied der Geschäftsleitung und bei Bitkom zuständig für Datenschutz, wirbt:
„Lassen wir Datenreichtum zu.“
Euphemismus-Warnung: Wer von „Datenreichtum“ spricht, verschweigt, wer eigentlich reich werden will und wer in Zukunft der Rohstoff sein soll, der ausgebeutet wird. Deshalb gab es für dieses Wort im letzten Jahr auch schon den Neusprech-Award!
Bitkom propagiert „Datensouveränität“ statt Datenschutz. So plädiert zum Beispiel Geschäftsführer Rohleder dafür, dass „der mündige Verbraucher durch datensouveränes Verhalten entscheiden können muss“, was er nutzen und mit wem er Informationen teilen wolle.
Euphemismus-Warnung: „Datensouveränität“ ist eine schöne Idee, aber wer das sagt, tut so, als ob die Verbraucher.innen tatsächlich die Macht hätten, zu entscheiden, wer was von ihnen erfährt. Aber so ist es nicht. Mit dem Wort „souverän“ soll den Menschen suggeriert werden, dass Gesetze zu ihrem Schutz überflüssig seien und dass Verbraucherschutz Bevormundung sei.
Wer fordert, dass „Datensouveränität“ nun den Datenschutz ersetzen soll, will nicht die Persönlichkeitsrechte der Bürger schützen, sondern Datenkraken-Firmen vor wirksamen Gesetzen. Denn „souverän“ klingt nett, ist aber wolkig statt rechtsverbindlich.
Wer von „individueller Datensouveränität“ spricht, meint damit die Digitalversion des „mündigen Bürgers“ – der normalerweise nicht gefragt wird, aber der immer dann herbeizitiert wird, wenn er über den Tisch gezogen werden soll.
„Souverän“ klingt erst mal gut. Wollen wir das nicht alle – souverän sein? „Souverän“ ist magischer Feenstaub und Bitkom stäubt ihn wie Puderzucker über unsere kritische Wahrnehmung. Wusch – weg sind die Persönlichkeitsrechte. Plopp – da sind die Daten als Wirtschaftsware, die die Verbraucher.innen einfach weitergeben können. Magischerweise entsteht so der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, der aber – simsalabim – erst dann wirklichen Wert hat, wenn er in die Hände der datensammelnden Firma gerät.
Und Bitkom-Präsident Thorsten Dirks legt noch einen drauf:
„Das Prinzip der Datensparsamkeit hat sich in fast allen Lebensbereichen überholt. Wir wollen kein Supergrundrecht auf Datenschutz.“
Da erscheint vor meinem geistigen Auge doch gleich ein total unfaires Supergrundrecht, das die Wirtschaft drangsaliert. Jetzt mal im Ernst: Das ist doch absurd!
All dies wird immer und immer wieder wiederholt. Wir können es auch „Quengeln“ nennen.
Das Schlimme ist:
Das Quengeln zeigt Wirkung
Bundeskanzlerin Angela Merkel ist mittlerweile weich geworden und erfüllt dem IT-Kindergarten Bitkom jeden Wunsch. Denn diese Kinder behaupten ja, unsere Zukunft zu sein.
An dem einen Rockzipfel zerren die Firmen, die Überwachungstechnik verkaufen, an dem anderen Rockzipfel die Firmen, die freie Bahn für ihr Big Business mit Big Data wollen. Als gemeinsamer Feind ist ausgemacht: Der Datenschutz, der die Bürgerinnen und Bürger vor den schlimmsten Auswüchsen schützen soll.
Und das Quengeln wirkt nicht nur bei der Kanzlerin, sondern auch bei ihren drei Ministern, die gemeinsam fürs Digitale zuständig sind: Innenminister Thomas de Maiziére, Verkehrsminister Alexander Dobrindt und (bis vor kurzem) Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Denn wenn man den Mitgliedern der Bundesregierung zuhört, dann hat man fast das Gefühl, eigentlich die Bitkom-Sprecher zu hören, die wir eben zitiert haben:
Sigmar Gabriel auf IT-Gipfel in Saarbrücken 2016:
„Ich glaube, dass wir uns endgültig verabschieden müssen von dem klassischen Begriff des Datenschutzes, weil der natürlich nichts anderes ist als ein Minimierungsgebot von Daten. Das ist ungefähr das Gegenteil des Geschäftsmodells von Big Data. Aber das heißt nicht Aufgabe jeder Form, sondern, statt Datenschutz ‚Datensouveränität‘ zum Gegenstand von Politik und Umgang mit Daten zu machen.“4
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt auf einem Empfang von Bitkom:
„Der bisher gültige Grundsatz, dass Datensparsamkeit das Übermaß der Dinge ist, der hat sich überholt, der muss weg. Datenreichtum muss der Maßstab sein, nach dem wir unsere Politik ausrichten.“5
Dafür wolle sich die Regierung zusammen mit Bitkom einsetzen.
Auch Angela Merkel zeigt viel Verständnis für die Big-Data-Wünsche:
„Sie brauchen hinreichend Freiheiten, um neue Daten, um neue Möglichkeiten des Datenmanagements, des Big Data Minings oder auch die Cloud für Ihre Geschäftsmodelle zu nutzen. Ich glaube, das ist eine bis jetzt, jedenfalls in Deutschland, noch nicht richtig erkannte Form der Wertschöpfung. Daten sind Rohstoffe des 21. Jahrhunderts“,
sagte sie auf einer Verlegertagung 2015 in Berlin.
„Wenn wir es nicht machen, machen es andere,“ sagt Thomas de Maiziére in seiner Bundestagsrede zum BDSG-Anpassungsgesetz. Das ist allerdings ein Argument, das man auch als Entschuldigung für Waffenhandel, Zuhälterei und Drogen-Dealen anführen könnte – und das wir nichtsdestotrotz moralisch verwerflich finden.
Bitkom genießt seinen Einfluss auf die Regierung. Manchmal ein bisschen zu sehr. So sagte ein Bitkom-Vertreter bei einer Anhörung zum E-Government-Gesetz triumphierend: „Was soll ich denn gegen ein Gesetz sagen, das ich selbst geschrieben habe?!“ Niemand bei der Anhörung schien Anstoß daran zu nehmen – soweit geht die Selbstverständlichkeit der Lobby-Einflussnahme.
Und nun raten Sie mal, was als nächstes kommt in unserer Liste der Kritikpunkte:
Die altbekannte Strategie der „freiwilligen Selbstverpflichtung der Wirtschaft“.
Für die Einflussnahme in Brüssel hat Bitkom den gemeinnützigen Verein „Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V.“, kurz SRIW, gegründet, der sich für „Selbst- und Ko-Regulierung“ einsetzt, unter anderem in einem Ausschuss der EU-Kommission. Mit anderen Worten: Er deckt das Feld Daten- und Verbraucherschutz ab, um zu suggerieren, dass die Verbraucher.innen Vertrauen haben können, weil die Wirtschaft sich doch schon selbst um diese Anliegen kümmert. Neben Bitkom gehören zum Verein SRIW: die Deutsche Telekom, DHL, Map & Route, zwei Unternehmen für Panoramabilder, Vermessung und Georeferenzierung à la Streetview – und, ja genau: Google.
Fun fact am Rande: Die überschäumende Freude, wie gut das mit der Beeinflussung der Politik funktioniert, hat gleich zu zwei Freud’schen Verschreibern auf der SRIW-Website geführt: „sanktionsbewährt“ mit „ä“ – naheliegend, denn die Strategie des Verbandes, durch Selbstregulierungstamtam Gesetzgebung zu verhindern, ist in der Tat „altbewährt“ – „wehrhaft“ dagegen sollen die Persönlichkeitsrechte ja eben nicht sein.
Vielsagender Vertipper Nummer 2: „Die digitale Agenda der Bundesregulierung“ – die Bundesregierung schon komplett ersetzt durch Selbstregulierung. Hm, hier war offenbar der Wunsch Vater des Gedankens. Oder Google hat bei der Übersetzung geholfen.
Freie Bahn für Big Data
Aber Spaß beiseite – die Sache ist ernst. Worum geht es bei der Bitkom-Lobbyarbeit eigentlich? Um freie Bahn für Big Data Geschäftsmodelle. Big Data bedeutet: Jede Menge Daten werden über uns en passant gesammelt – nicht nur, welche Webseiten ich zur Information anschaue, was ich kaufe, wohin ich reise, sondern auch, wie ich mich bewege, wie schnell ich tippe und wie oft ich mich verschreibe, wie viele Nachrichten ich versende, ob ich auf Sonderangebote klicke und ob ich mich unter Zeitdruck zu Entscheidungen drängen lasse … und und und. Auf diese gemischten Daten wollen Firmen ihre Algorithmen loslassen und schauen, ob sie interessante Muster erkennen können.
Aus den gesammelten Daten werden Schlussfolgerungen über unser Verhalten und unsere Motive sowie Prognosen über unser zukünftiges Verhalten angestellt. Und diese Prognosen werden von denen verwendet, die sie zu ihrem Vorteil nutzen können. Wir werden nicht mehr gefragt. Big Data nimmt uns unsere Souveränität.
Rührend, wie immer wieder nach guten Zwecken gesucht wird, für die Big Data angeblich die Lösung sein soll: Gesundheit, bessere Verkehrsleitung, medizinischen Erkenntnisse, betrügerische Gebrauchtwagenhändler identifizieren, … ach ja, Arbeitsplätze natürlich auch.
Big Data ist ein Euphemismus. Denn eigentlich geht es um die Enteignung von Menschen – um die Enteignung von ihren Daten, von ihren Motiven, von ihren Wünschen, Plänen und Träumen und um die Enteignung von ihren eigenen Entscheidungen. Es geht um Manipulation und Kontrolle. Es geht darum, Claims abzustecken.
Aber Lobbyarbeit ist doch Bitkoms Aufgabe?
Klar – sie machen ihren Job. Aber sie machen ihn schlecht! Denn sie arbeiten nicht nur gegen Grundrechte und soziale Gerechtigkeit, sondern sie schaden letzten Endes auch der deutschen und europäischen IT-Wirtschaft. Denn der Wildwuchs an Datenaneignung zerrüttet das Vertrauen der Nutzer.innen – Misstrauen und mangelnde Akzeptanz werden die langfristige Folge sein.
Die Lobbyisten von Bitkom tun so, als ob wir Angst vor Neuerungen hätten. Dabei sind sie es, die nicht den Mut haben, eigene Lösungen zu erdenken und Dinge anders zu machen als die großen Brüder in den USA. Warum nutzen sie nicht die Vorteile, die deutsche und europäische Unternehmen haben, weil sie seit langem mit Datenschutz, Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechten, Umweltschutz und anderen Werten vertraut sind? Mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung gilt ab 2018 das Marktortprinzip. Das heißt, alle, die in Europa Geschäfte machen wollen, müssen sich an die hier geltenden Datenschutzregeln halten – egal, wo ihre Firma angesiedelt ist. Auch deshalb ist „Wenn wir’s nicht machen, machen es andere!“ ein schlechtes Argument.
Warum also sind die Bitkom-Verantwortlichen nicht selbstbewusst und bringen die deutsche Wirtschaft voran? Warum nutzen sie nicht die Qualität und die Kompetenz, die deutsche Unternehmen in diesem Bereich haben? Spannende Frage – wir haben eine mögliche Antwort:
Bei Bitkom bestimmen US-Konzerne den Kurs
8 Prozent der rund 1.600 Bitkom-Mitglieder kommen aus den USA. Das klingt erst einmal gar nicht sooo viel. Aber wenn wir nicht auf die reine Mitgliederzahl schauen, sondern wer diese 8 Prozent sind, die sich neben den deutschen Mittelständlern tummeln, dann sollte der Groschen fallen: Amazon, Apple, Cisco, Ebay, Facebook, Google, Hewlett Packard, IBM, Intel, Paypal, Xerox und Microsoft – die Hechte im Karpfenteich in Sachen Umsatz, Macht und Marktbeherrschung. Daneben hat’s auch noch Marktforschungsunternehmen (Forrester), Unternehmensberatungen (Accenture), Wirtschaftsprüfer (PriceWaterhouseCoopers), Cloud- und CRM-Anbieter (Salesforce), GPS-Navigation (Garmin), Scoringunternehmen (Fair Isaac), Trackinganbieter (Zebra Technologies) und echte Sympathieträger wie Taxi-Konkurrenz Uber.
Die Machtverhältnisse bilden sich auch im Bitkom-Präsidium ab: Von den 16 Menschen im Bitkom-Präsidium sind 5, also fast jede.r Dritte, von einer US-Tochterfirma.
Und in der Tat: Seit Jahren bestimmen US-Internetkonzerne den Kurs von Bitkom. Von dort kommen die Ressourcen. Sie sagen, wo es langgeht. Wir könnten es auch nicht-staatlichen Kolonialismus nennen. Bitkom ist kein deutscher IT-Verband mehr – sondern Bitkom ist inzwischen eine Lobbyorganisation von US-Konzernen, die unter falscher Flagge segeln.
Liebe Bitkoms: Wir wünschen Ihnen mehr Mut zu einem eigenen deutschen und europäischen Weg, mehr Eigenständigkeit, eigene Visionen, echte Innovation! Besinnen Sie sich auf die eigenen Qualitäten, entmachten Sie die US-Konzerne in Ihrem Verband und hören Sie auf, gegen den Datenschutz zu quengeln.
Liebe Bundesregierung: Hören Sie auf, dem Bitkom-Kindergarten jeden Wunsch zu erfüllen, solange sich dieser nicht von dem Einfluss der US-Konzerne befreit hat. Wer quengelnden Kindern dauernd nachgibt, tut auf lange Sicht weder der Gesellschaft noch den Kindern selbst einen Gefallen.
Möge der BigBrotherAward daran erinnern – herzlichen Glückwunsch, Bitkom!
Antwort des Preisträgers
BigBrotherAwards-Preisträger Bitkom kann den Preis zwar nicht persönlich entgegennehmen, grüßt aber mit einer Videobotschaft.