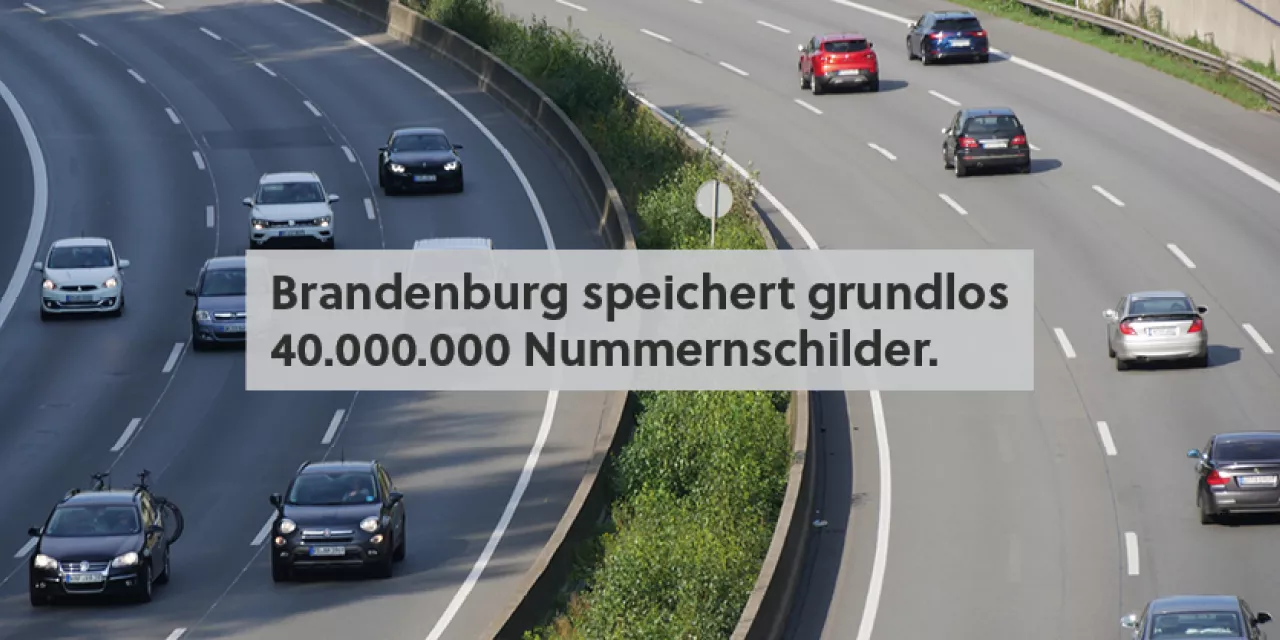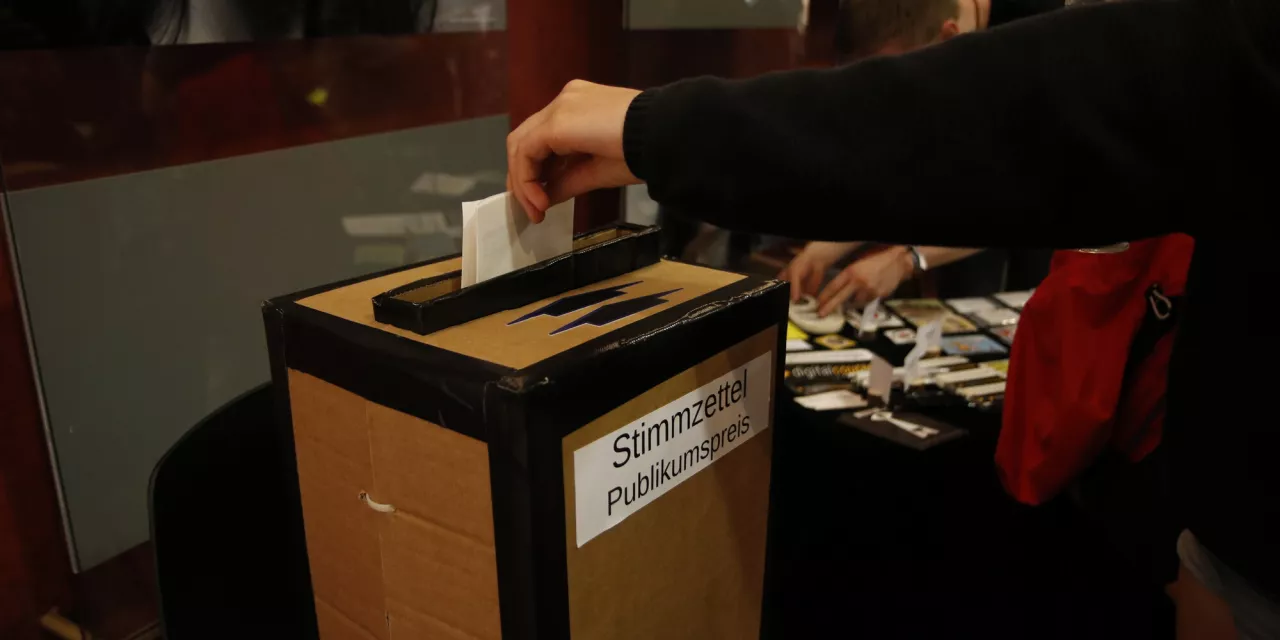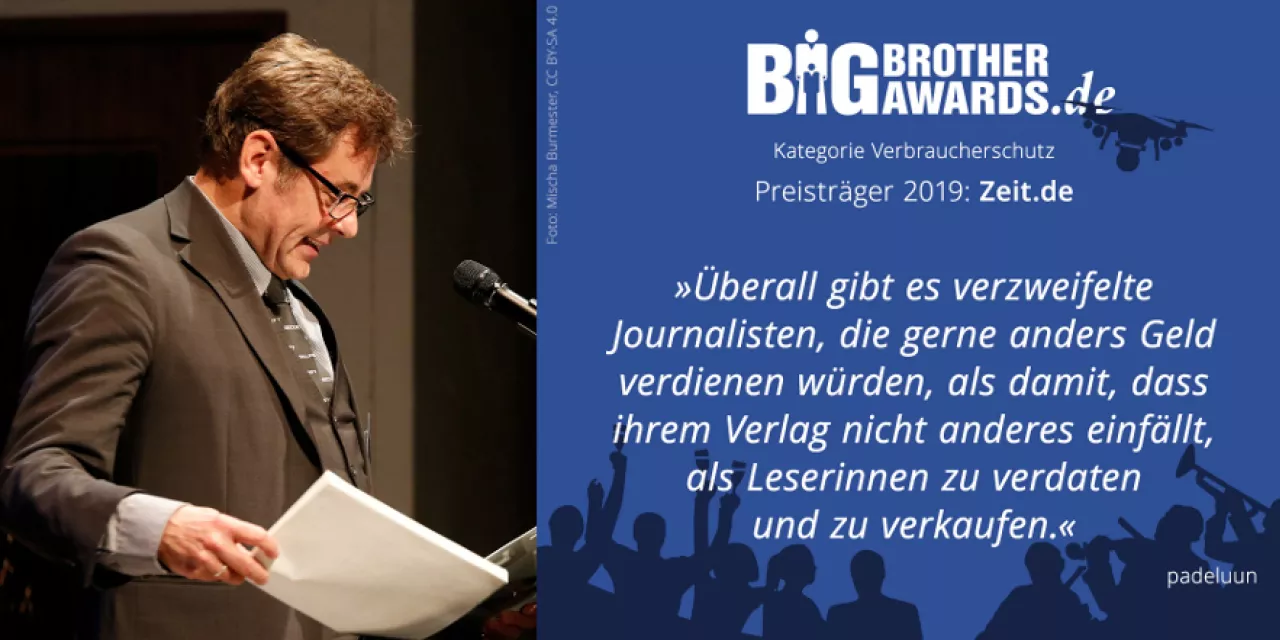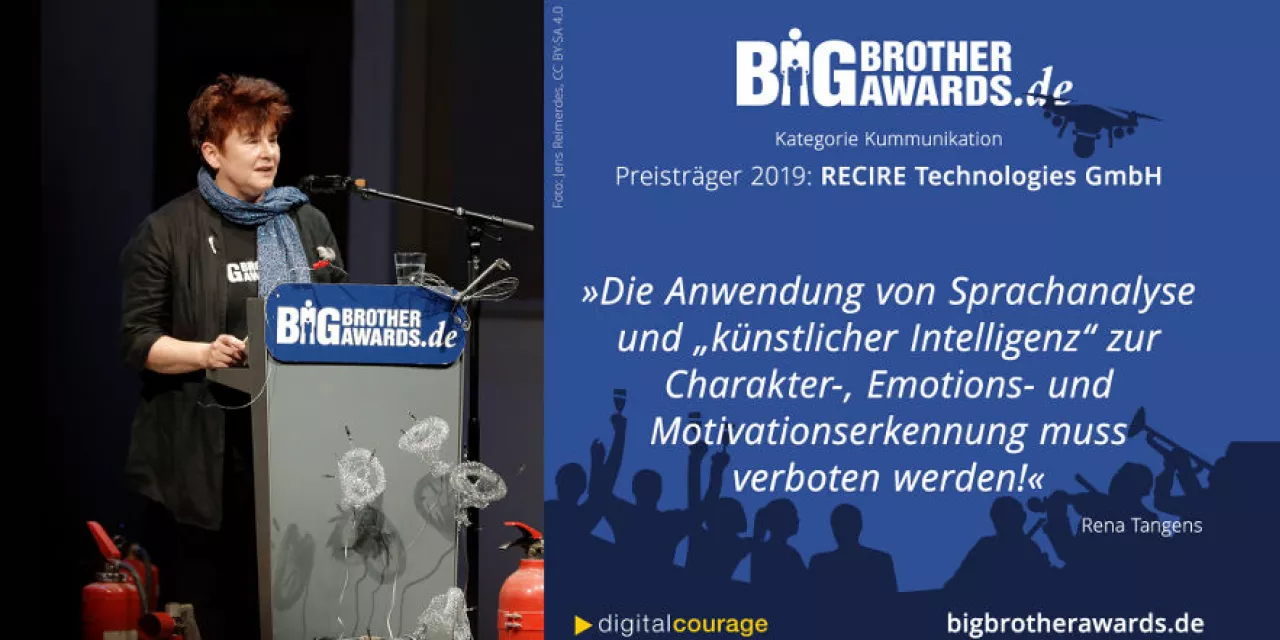Bildungsministerin des Landes Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann

Der BigBrotherAward 2020 in der Kategorie „Digitalisierung“ geht an Susanne Eisenmann, Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg (und Spitzenkandidatin der CDU zur Landtagswahl 2021), weil sie wesentliche Dienste der Digitalen Bildungsplattform des Landes von Microsoft betreiben lassen will. Damit liefert sie die Daten und E-Mails von allen Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern Baden-Württembergs an das US-Unternehmen und die US-Geheimdienste aus.
Natürlich gibt es Warnungen und Bedenken gegen so eine Entscheidung – aber Frau Dr. Eisenmann ist nicht zu bremsen: In wenigen Wochen soll es losgehen, hat das Ministerium im Bildungsausschuss des Landtages Anfang Juli verkündet.1
Wie konnte es so weit kommen?
Unsere Preisträgerin, Kultusministerin Susanne Eisenmann, steht unter erheblichem Druck. Im Februar 2018 hat sie die damals geplante, selbst betriebene Bildungsplattform „Ella“ wegen erheblicher technischer Mängel gestoppt,2 drei Tage vor dem Testbetrieb in 100 Schulen. Dann folgte ein Pannenbericht auf den nächsten: Gutachten offenbarten, dass der beauftragte landeseigene IT-Dienstleister eigenmächtig Subunternehmer beauftragt hatte.3 Absprachen waren unklar. Der Landesrechnungshof monierte „erhebliche Mängel im Projektmanagement“.4 Die Ministerin warf den kommunalen Haupt-Dienstleister aus dem Projekt.5 Und alles sollte noch mal neu aufgesetzt werden. Die Zeitungen titelten immer wieder „ein Scherbenhaufen“ oder „Bildungsplattform steht vor dem Aus“. Zweieinhalb Jahre lang.
Nun will Frau Eisenmann im kommenden Jahr als Ministerpräsidentin für Baden-Württemberg kandidieren, und die Corona-Krise hat das Gaspedal, was Digitalisierung von Schulen angeht, nochmal so richtig durchgetreten. Deshalb muss die Digitale Bildungsplattform endlich funktionieren, bevor der Wahlkampf in die heiße Phase geht! Bedenken Second!
Warnungen vor Microsoft gab es genug.
Fangen wir mit unserer eigenen Warnung an: Nach dem BigBrotherAward 2002 an Microsoft fürs Lebenswerk6 vergaben wir 2018 den Preis für die Übermittlung von Telemetriedaten durch Windows 10.7 Der Datenhunger wächst.
Die vom Ministerium geplante Version „A3“ von Microsoft 365 enthält Schreib- und Tabellensoftware, Dateiablage, Videokonferenzen, Mailserver etc.8 Gespeichert wird alles auf Microsoft-Servern und die Software erhebt genaue Daten, z.B. wann welcher Nutzer wie lange an einem Dokument arbeitet.9 „Ist kein Problem“, sagt das Ministerium, „denn in der A3-Version lassen sich Privatsphäre-Einstellungen konfigurieren.“10 Mag sein, Frau Ministerin, aber eben nicht alle. Die sogenannten „wesentlichen Dienste“ lassen sich nicht deaktivieren.11
Sehr skeptisch ist auch der Landesbeauftragte für den Datenschutz, Dr. Stefan Brink. Er bezweifelte in einer Stellungnahme, ob Microsoft 365 in Schulen eingesetzt werden darf: „Es scheinen derzeit strukturelle Merkmale […] vorzuliegen, welche die Möglichkeit eines datenschutzkonformen Einsatzes ohne wesentliche Anpassung der Datenverarbeitung durch Microsoft fraglich erscheinen lassen.“12 Die von der Ministerin beauftragte Datenschutz-Folgenabschätzung der Firma PwC, die übrigens laut ihrer Website mit Microsoft kooperiert13, habe „methodische Mängel“ und müsse „vor einem etwaigen Einsatz des Produkts“ erheblich überarbeitet werden.14
Damit nicht genug: Selbst ein frisches Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) hat die Ministerin nicht erschüttert. Dieser hat am 16.7.2020 das Datenschutzabkommen „Privacy Shield“ zwischen der EU und den USA für ungültig erklärt.15 Damit ist klar, was eigentlich schon vorher klar war: Daten von Nicht-US-Bürger.innen, die ein US-Amerikanischer Konzern erhebt und speichert, können mit Hilfe des CLOUD Acts16 und FISA17 auch von US-Geheimdiensten ausgelesen werden.
Noch 12 Tage später argumentiert Frau Eisenmann in einer Presseerklärung18, ein Server in der EU würde das Problem lösen. Nein. Einfach nur Nein. Das Versprechen von Microsoft, die Daten ausschließlich auf Servern in der EU zu speichern, ist wertlos. Den US-Schnüffelbehörden ist egal, wo der Server steht.19 Das sagen Ihnen Fachleute – die Sie in Ihrer Pressenotiz herablassend als „selbsternannte Datenschützer“ bezeichnen – schon seit langer Zeit.
Sie aber haben sich auf Microsoft festgelegt.20
Dabei arbeiten viele Schulen in Baden-Württemberg bereits mit dem sicheren Messenger Threema, der freien Lehrsoftware Moodle und der freien und datenschutzfreundlichen Videokonferenz-Software BigBlueButton. Und die Erfahrungen sind gut, haben Sie selbst gesagt.21 Warum also wollen Sie unbedingt wechseln? Wir verstehen es nicht.
Es ist uns auch unbegreiflich, warum die von Ihnen beauftragte Datenschutz-Folgeabschätzung und die Antwort Ihres Landesdatenschutzbeauftragten22 bei so einer wichtigen Entscheidung nicht für Lehrkräfte und Eltern transparent gemacht werden.
Stattdessen hören wir von Eltern und Lehrern in Baden-Württemberg seit Monaten, es gebe „Maulkörbe aus dem Ministerium“, oder „ich darf nicht darüber sprechen“, oder „ich werde nicht ernst genommen.“23
Es soll nun endlich losgehen!
Im Herbst sollen zunächst die Lehrkräfte an einigen Dutzend Schulen E-Mail-Adressen und einen „persönlichen Arbeitsplatz“ mit Office-Software und Online-Speicher erhalten, alles von Microsoft 365, Speicherort: Microsoft-Server. Dabei geht es aber nicht nur um die Daten von Lehrkräften, die das Kultusministerium Microsoft in den Rachen wirft (was schon schlimm genug wäre): In Schulkonferenz-Protokollen, Excel-Tabellen oder E-Mails zwischen Lehrkräften verbergen sich automatisch auch sensible Daten über einzelne Kinder. Das lässt sich gar nicht sinnvoll trennen.
Und das wollen Sie ohne ausreichende Datenschutz-Folgeabschätzung durchwinken? Bis jetzt wurde die vernichtende Kritik des Landesdatenschutzbeauftragten nicht schlüssig entkräftet. Ob das bis zum Projektstart gelingt, halten wir für fraglich. Und ob Microsoft dann noch die geforderten Anpassungen bis Oktober vornehmen kann, ist umso fraglicher. Aber Sie, Frau Eisenmann, sind wild entschlossen.
Was für ein Coup für Microsoft!
Eine Schulplattform von Microsoft ist ein Dammbruch. Wenn sich Baden-Württemberg als erstes Kultusministerium in diese Abhängigkeit begibt, werden andere Bundesländer folgen.
Dabei sind E-Mails und Arbeitsplätze für Lehrkräfte nur der erste Schritt. „Mittelfristig“, so der Plan des Ministeriums, werden auch die Kinder die zentrale Dateiablage nutzen.24 Und später werden ihnen auch die Office-Pakete zur Verfügung stehen – alles andere wäre bildungspolitischer Unsinn.
Dann werden sie schon von klein auf mit den Microsoft-Produkten vertraut gemacht und sich später kaum auf andere Software umstellen wollen. Das freut den Konzern. So kann er nämlich das Verbot von Produktwerbung an Schulen umgehen, denn er ist dann ja offiziell autorisierter Dienstleister des Ministeriums. Dieser Lock-in-Effekt gepaart mit den Datenschutz-Risiken ist ein pädagogischer Kardinalfehler.
So haben wir uns das mit der digitalen Souveränität25 nicht vorgestellt.
Und noch etwas: Die Schulplattform mit Microsoft ist eine Zeitbombe.
Im ersten Schritt werden nur die Lehrkräfte angeschlossen. Die wehren sich vielleicht noch nicht – schließlich ist das eine Entscheidung ihres Arbeitgebers. Aber dann, in ein paar Monaten, kommen die Eltern ins Spiel.
Wir wissen, dass viele Eltern und Lehrkräfte in Baden-Württemberg nicht einverstanden sind mit datensammelnder Software. Was ist, wenn sie ihre Grundrechte wahrnehmen und klugerweise die Datenschutzerklärung von Microsoft nicht akzeptieren wollen? Wollen Sie dann ein Ja erzwingen? Oder Kinder vom Unterricht ausschließen? Die Zustimmung zur Datenverarbeitung muss freiwillig sein – da beißt sich die DSGVO mit der Schulpflicht, Frau Ministerin, oder?
Würden Sie, liebe Frau Eisenmann, wollen, dass ein Konzern und US-Geheimdienste wissen, was Sie in ihrer Jugend über gängige Erörterungs-Themen der 70er-Jahre in Aufsätzen geschrieben haben? Über Sterbehilfe? Abtreibung? Homosexualität? Oder Todesstrafe? Diese Frage sollten sich im Übrigen auch andere Schulen und Ministerien stellen, die mit Microsoft liebäugeln. Sie dürfen sich gerne von dieser Laudatio mit angesprochen fühlen, wenn wir sagen:
Frau Eisenmann, kehren Sie um!
Stoppen Sie Ihre Pläne zur Einführung von Microsoft 365 als Bestandteil der Bildungsplattform, bevor es zu spät ist! Bevor Eltern- und Lehrerverbände Sie mit einer Klagewelle überziehen.
Gehen Sie den Weg weiter, den Sie mit dem Einsatz von Threema, BigBlueButton und Moodle bereits eingeschlagen haben: Setzen Sie weiter auf Freie Software, offene Formate, Dezentralität und auf Nextcloud (Software, die übrigens direkt vor Ihrer Haustür, in Stuttgart, entwickelt wird). Kostentechnisch ist das sowieso das Beste. Das findet auch der Landesrechnungshof.26
24 Millionen sind für die Bildungsplattform Baden-Württemberg geplant. Investieren Sie dieses Geld in die Anpassung freier Software für Ihre Belange! Bauen Sie Know-How auf! Rüsten Sie Server-Systeme und Speicherplatz auf, so wie Sie es beim Moodle-Einsatz zu Beginn der Corona-Krise getan haben.27 Vom so investierten öffentlichen Geld profitieren dann nämlich auch andere. (Stichwort: „Public Money? Public Code!“)
Ja, das wird dann vor der Landtagswahl nicht mehr alles fertig. Aber Eltern und Lehrkräfte werden Ihnen danken. Und unsere freiheitlich-demokratischen Bildungsideale – die es allemal wert sind, erhalten zu werden – auch.
Herzlichen Glückwunsch zum BigBrotherAward 2020 in der Kategorie Digitalisierung, Frau Dr. Susanne Eisenmann.
Verantwortlich für den Text: Claudia Fischer, Jessica Wawrzyniak, Leena Simon
Laudator.in

1 Video der Sitzung des Bildungsausschusses, Antwort des Ministeriums bei 2:18:00 (Web-Archive-Link)
2 Digitale Bildungsplattform „ella“ nicht betriebsfähig (Web-Archive-Link)
3 rnz.de: Digitale Bildungsplattform steht möglicherweise vor dem Aus (Web-Archive-Link)
4 https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20190909_Rechnungshof_Gutachten_ella.pdf [Inhalt nicht mehr verfügbar]
5 badische-zeitung.de: Steht "Ella" vor dem Aus? (Web-Archive-Link)
6 BigBrotherAward in der Kategorie Lebenswerk geht an Microsoft Deutschland
7 BigBrotherAward 2018 in der Kategorie Technik geht an Microsoft Deutschland
8 Die vollständige Liste, was alles zum A3-Paket von Microsoft 365 gehört (z.B. auch die Videokonferenz-Software „Teams“), finden Sie hier [Inhalt nicht mehr verfügbar]
9 So genannte Telemetrie- und Diagnosedaten (Web-Archive-Link)
10 Video der Sitzung des Bildungsausschusses, bei 2:17:00 (Web-Archive-Link)
11 Dabei handelt es sich auch um Telemetrie- oder Diagnisedaten; siehe https://docs.microsoft.com/de-de/deployoffice/privacy/essential-services, unten links lässt sich auch ein PDF mit 567 Seiten herunterladen. Ab Seite 301 geht es um „eine Reihe von Diensten, die für die Funktionsweise von Office wesentlich sind und daher nicht deaktiviert werden können.“ (Web-Archive-Link)
12 badische-zeitung.de: Eisenmann setzt auf Microsoft-Plattform für Schulen und erntet Kritik vom 23.7.2020 (Web-Archive-Link)
13 pwc.com: PwC and Microsoft - Global Alliance partners (Web-Archive-Link)
14 ebenda
15 Hintergrund im Digitalcourage-Blog (Web-Archive-Link)
16 CLOUD Act (Web-Archive-Link)
17 Foreign Intelligence Surveillance Act (Web-Archive-Link)
18 km-bw.de: Microsoft Office 365 an Schulen (Web-Archive-Link)
19 Und wir erinnern uns: Microsoft war der erste Partner beim PRISM-Programm der NSA (Web-Archive-Link)
20 z.B. in der Formulierung des Kultusministeriums in einer Antwort auf eine Anfrage der FDP Drucksache 16/8553: „Die Beratung seitens des LfDI bedeutet für das KM eine wertvolleUnterstützung hin zu einem datenschutzkonformen Einsatz von MS365 an Schulen.“
21 Zum Beispiel in Antworten auf Anfragen der FDP, Drucksachen 16/7925 und 16/8132
22 badische-zeitung.de: Eisenmann setzt auf Microsoft-Plattform für Schulen und erntet Kritik (Web-Archive-Link)
23 Siehe z.B. die folgenden Anfragen nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz Baden-Württemberg (LIFG), die das Ministerium entgegen der Pflicht aus dem LIFG nicht beantwortet:
Datenschutzfolgeabschätzung (Web-Archive-Link)
Digitale Bildungsplattform, Antrag auf Akteneinsicht nach dem LIFG (Web-Archive-Link)
Kommunikation mit Vertretern von Microsoft (Web-Archive-Link)
Marktanalyse zu digitale Schul-/Bildungsplattformen (Web-Archive-Link)
Abwägung zum Einsatz von Onlinelösungen der Firma Microsoft im Bildungsbereich (Web-Archive-Link)
24 Tischvorlage des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport am 26.9.2019, Seite 7
25 digitalcourage.de: Ein Ort für öffentlichen Code (Web-Archive-Link)
26 https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-im/intern/dateien/pdf/20190909_Rechnungshof_Gutachten_ella.pdf (PDF) [Inhalt nicht mehr verfügbar]
27 Video der Sitzung des Bildungsausschusses, Antwort des Ministeriums ab 2:24:00 (Web-Archive-Link)